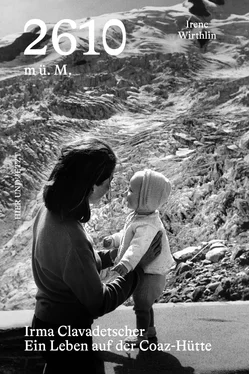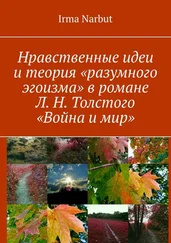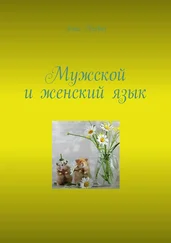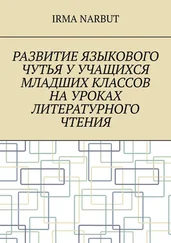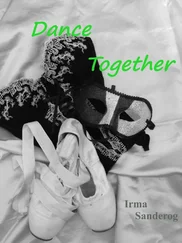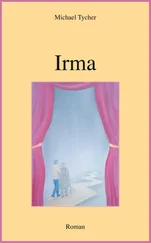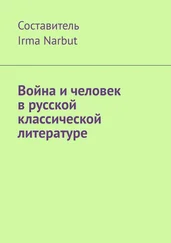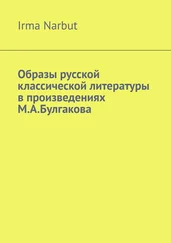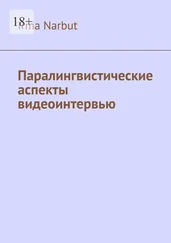Wenn sie und Franz nur endlich wieder einmal draussen spielen dürften. Langsam wird ihnen langweilig im Haus, denn das neue Schwesterchen ist eine Enttäuschung, man kann gar nichts mit ihm anfangen; wenn es nicht schläft, schreit es, und Hedi versteht nicht, warum die Mutter dann immer gleich nach ihm schaut. Nie sagt sie zu ihm: «Du musst jetzt warten; ich habe in der Küche zu tun, in einer Stunde gibt es Mittagessen», was sie zu ihr oder Franz oft sagt. Es gefällt Hedi nicht, dass die Mutter so wenig Zeit hat, und sie hat manchmal Heimweh nach dem Vater. Als er einmal vom Militärdienst nach Hause kommt, darf er das Haus nicht betreten und muss bei der Grossmutter im Dorf übernachten. Er steht draussen auf der Strasse, ruft und winkt den Kindern zu.
Die Spenglerei Müller 1940–1945
Trotz der Unruhe und den Ängsten, die in der Luft liegen, verlaufen Irmas erstes Lebensjahr und auch die folgenden Jahre in ruhigen Bahnen. Die langen Abwesenheiten des Vaters und sein sporadisches Auftauchen sind für die Kinder zur Normalität geworden, nur Hedi, das älteste der Kinder, macht sich manchmal ihre Gedanken; zum Beispiel über den riesigen Rucksack, der immer voll bepackt im Hausflur steht und den man unter Androhung von Strafe weder berühren noch wegschubsen darf. «Er muss bereit sein, für den Fall, dass …», erklärt die Mutter. «Für welchen Fall? Was ist ein Fall?», fragt Hedi. – «Ach, was du immer alles wissen willst! Und jetzt muss ich zusehen, dass die Suppe auf den Herd kommt.» Und Hedi fragt sich, ob vielleicht der Rucksack nützlich sein könnte, wenn jemand hinfallen würde.
Die Mutter ist auch immer kurz angebunden, wenn es darum geht, abends die dicken, neuen Vorhänge zuzuziehen. Nicht der kleinste Lichtspalt dürfe nach draussen dringen, sagt sie immer wieder. Überhaupt gibt es Dinge, bei denen die Mutter jetzt so unerbittlich streng ist wie sonst nur der Vater. Vor dem Mittagessen schaltet sie immer das Radio ein, und wenn dann die Stimme im Radio sagt: «Beim dritten Ton ist es genau zwölf Uhr dreissig», und es dreimal so merkwürdig pfeift, macht sie das Radio noch lauter, und man muss augenblicklich mucksmäuschenstill sein. Und dann redet ein Mann ganz lange, und man darf immer noch nichts sagen, obwohl der Vater doch gar nicht mit am Tisch sitzt.
Aber bald gehören der Rucksack, die zugezogenen Vorhänge nachts und das absolute Sprechverbot während der Mittagsnachrichten von Radio Beromünster zum Alltag und werden mit kindlicher Unbeschwertheit akzeptiert. Viel aufregender ist, dass die Familie nun bald umziehen wird; in ein neu gebautes, grosses Haus einige Hundert Meter dorfauswärts, an der Hauptstrasse 77. Das Gebäude ist schon fast fertig, auch die daran angebaute Werkstatt. Die Mutter hat es den Kindern einmal gezeigt, als ein Maler gerade die letzten Buchstaben des schwarzen Schriftzugs SPENGLEREI MÜLLER an die Aussenwand der Werkstatt pinselte. Noch in diesem Jahr werden sie dort einziehen.
«In solchen Zeiten baut man doch kein Haus. Wer weiss, was in den nächsten Monaten hier geschieht. Wenn du mich fragst, der ist verrückt», hört man in Schmerikon. Tatsächlich sind überall Angst und Beunruhigung zu spüren, als sich die Schweiz im Juni, nach Frankreichs Zusammenbruch und Italiens Eintritt in den Krieg, von zwei totalitären Nachbarstaaten umgeben sieht. Viele Schweizerinnen und Schweizer fürchten eine Vereinnahmung durch nationalsozialistisches Gedankengut oder gar einen Angriff auf die Schweiz. Die einen befürworten den unbedingten Widerstand, um die Unabhängigkeit der Schweiz zu wahren, die anderen glauben, Deutschlands Wünsche möglichst zu erfüllen, werde am ehesten das Überleben der Schweiz sichern. «Anpassung oder Widerstand?» lautet die Frage, die jede Schweizerin, jeden Schweizer beschäftigt.
Aber der 32-jährige Franz Müller lässt sich weder von den einen noch von den anderen abhalten und baut im ersten Kriegsjahr ein Haus und eine Werkstatt, obwohl auch er, wie die meisten Soldaten, einen guten Teil des Jahres Aktivdienst leistet. Vor sieben Jahren eröffnete er mit bescheidensten Mitteln seine eigene Spenglerwerkstatt im Dorf und fuhr mit dem Fahrrad oder dem Handwagen zu seinen Kunden, wie die anderen Handwerker auch. Jetzt ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, er möchte sich vergrössern, Kriegsängste hin oder her. Er hat Pläne, ist ehrgeizig, will sich im Dorf einen Namen machen. Vor allem will er für seine wachsende Familie gut sorgen. Seine Frau soll sich nicht abrackern müssen wie einst seine Mutter, die früh Witwe wurde und ihre drei Söhne kaum durchbrachte; und seinen Kindern soll niemals der Geruch der Armut anhaften, unter dem er selbst so gelitten hat. Sie sollen im stolzen Bewusstsein aufwachsen, dass ihr Vater jemand ist, der respektiert wird und auf den man im Dorf hört. Schon bald beschäftigt er in seiner neuen Werkstatt drei Arbeiter und einen Lehrling, und mitten im Krieg, 1943, wird sein zweiter Sohn, Jakob, geboren.
Franz Müller hat Glück, die Schweiz hat Glück: Sie bleibt verschont. Am 8. Mai 1945 kapitulieren die deutschen Streitkräfte bedingungslos, und es ist endlich Frieden in Europa. Abends um acht Uhr läuten im ganzen Land eine Viertelstunde lang die Kirchenglocken, und es finden spontane Dankgottesdienste statt. Die Angst fällt von den Menschen ab, die Freude explodiert förmlich; überall wird gesungen, getanzt und gefeiert.
Franz und Sophie Müller-Kuster: die Eltern
Mit dem Kriegsende kehrt in Schmerikon langsam wieder die Normalität ein, und in dem idyllisch gelegenen Dorf, mit seinen schilfbestandenen Seeufern, die den Blick nach Süden auf den gegenüberliegenden, bewaldeten Buchberg und nach Osten auf den Speer und den markanten Gipfel des Mürtschenstocks freigeben, nehmen Männer und Frauen wieder ihre traditionellen Rollen und ihre ursprüngliche Arbeit auf. Einige Zeit noch muss man zwar mit Lebensmittelmarken auskommen, aber bald nimmt das Alltagsleben seinen gewohnten Lauf. Am Sonntag pilgert man zum Gottesdient in die katholische Kirche St. Jodokus, die leicht erhöht über dem Dorf thront. Unten am See legt ab und zu ein Dampfschiff, von Rapperswil herkommend, am Steg an, und wenn man sich beim Einkaufen in der Hauptstrasse trifft, sind die Gesichter wieder entspannter und die Gesprächsthemen banaler.
1948, mit der Geburt einer dritten Tochter, Ursula, ist die Familie Müller komplett. Wiederum ist es, wie auch bei Irma und Jakob, eine Hausgeburt. Eines Abends fasst sich die Mutter während des Abendessens mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Seite, und die vier älteren Kinder werden zu ihrer Verwunderung noch bei Tageslicht ins Bett geschickt, um am anderen Morgen mit der Nachricht überrascht zu werden, sie hätten ein Schwesterchen bekommen. Nicht einmal die zwölfjährige Hedi hatte eine Erklärung gewusst, als Franz wenige Wochen zuvor festgestellt hatte, die Mama werde immer dicker, und auch Irma sich fragte, was wohl mit der Mutter nicht stimme. Und nun ist ein kleines Schwesterchen da, und die Mama wird bald wieder weniger dick sein, aber darüber wird in der Familie – wie wohl zu dieser Zeit in vielen anderen Familien auch – nicht gesprochen. Diese Dinge bleiben geheim. Und geheimnisvoll. Damit müssen sich die Geschwister abfinden, dazu Fragen zu stellen, das spüren sie genau, das geht auf keinen Fall.
Franz Müllers Geschäft blüht. Man kennt und schätzt ihn. Sein Hang zum Perfektionismus garantiert den Kunden eine sorgfältige, einwandfreie Arbeit. Die Spenglerei Müller geniesst in Schmerikon und in der Umgebung einen guten Ruf, sie ist geradezu zu einem Begriff geworden, sodass die Kinder bei einem Besuch von Frau Müller in Irmas Kindergartenklasse spontan schreien: «Grüezi, Frau Spengler!» Längst fährt Franz Müller nicht mehr mit dem Fahrrad zu den Baustellen, auch das Motorrad ist mit den Jahren durch einen glänzenden, schwarzen Mercedes ersetzt worden. Franz Müller ist angekommen. Er besetzt verschiedene Ämter im Dorf und erlangt schliesslich einen Sitz im Kantonsrat. Aufgewachsen als arme Halbwaise, gehört er nun zu jenen im Dorf, die das Sagen haben. Das verpflichtet natürlich und prägt das Familienleben, denn auch zu Hause erwartet und verlangt der Vater Ordnung, Disziplin und Wohlverhalten. Die Familie soll ihrer Stellung im Dorf gerecht werden.
Читать дальше