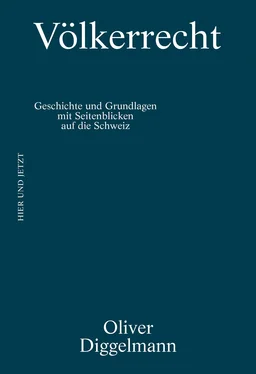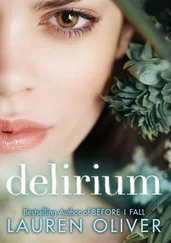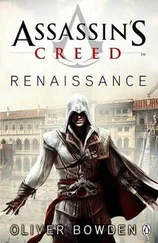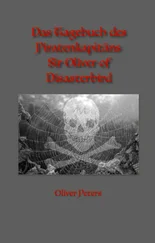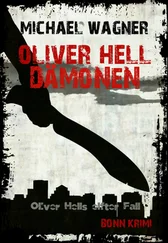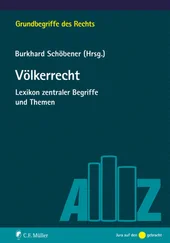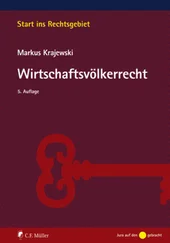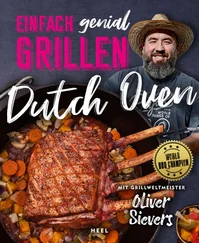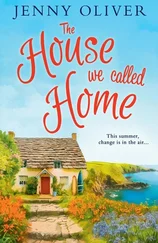Das heutige WTO-Recht beruht auf dieser Grundidee. Auch das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts erhielt ab der Jahrhundertmitte durch die Freihandelslehre einen Schub. Sie forderte den Abbau von Zöllen und eine stärkere Integration der Wirtschaftsräume. 1860 wurde zwischen Frankreich und Grossbritannien ein damals als bedeutend empfundener Vertrag geschlossen, der beide Staaten auf das «Prinzip der Meistbegünstigung» verpflichtete. 42Jede Zollsenkung für ein bestimmtes Gut, das irgendeinem Staat gewährt wurde, musste nun auch dem Vertragspartner zugestanden werden – mit dem Ziel, das Zollniveau generell zu senken. Die Schweiz hatte bereits 1850 einen solchen Vertrag mit den USA und 1855 einen mit Grossbritannien vereinbart.
Es kam zu ersten Kodifikationen völkerrechtlicher Teilgebiete. Den Anfang machte das humanitäre Völkerrecht mit der Schaffung der ersten Genfer Konvention «betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen» von 1864. Sie regelte den Schutz der Verwundeten und die Neutralität des Sanitätspersonals und war im Wesentlichen eine Folge davon, dass in den Kriegen der 1850er-Jahre viele Verwundete «unnötig» starben, weil es am erforderlichen Schutz und an der Wundversorgung fehlte. Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907, vom russischen Zaren Nikolaus II. initiiert, brachten überdies vertragliche Fixierungen verschiedener Aspekte der Kriegführung. 43Hier stand nicht der Schutz des Einzelnen, sondern die Einhegung des Kriegs an sich, beispielsweise durch bestimmte Verbote von Waffen und Kriegführungsmethoden, im Vordergrund. Man einigte sich etwa auf ein Verbot des Einsatzes von Gift. Im Gebiet des humanitären Völkerrechts begann früh, was später in vielen anderen Gebieten des Völkerrechts zu beobachten sein würde: eine starke Verschiebung vom Gewohnheits- zum Vertragsrecht, das nun zur dominierenden Rechtsquelle wurde. Das Völkerrecht wurde durch diese Verschiebung insofern gestärkt, als es einfacher ist, Gewohnheitsrecht entweder zu bestreiten oder als blosse Völkermoral abzutun. Obschon sich die internationale Situation im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und vor allem gegen dessen Ende zusehends zuspitzte, gab es in dieser Zeit bei vielen einen grossen Glauben an den Fortschritt durch Völkerrecht. In den Begriffen «Völkerrecht» und «ius gentium» klang die Idee einer Art «Weltvernunft» an. Eine moderne Völkerrechtswissenschaft entstand, die dieses Projekt voranzutreiben versuchte. Der Finne Martti Koskenniemi (geb. 1953) hat den Aufstieg dieser neuen Wissenschaft mit ihrer Mission in seinem 2001 erschienenen Buch «The Gentle Civilizer of Nations» beschrieben.
Aufkommen der Schiedsgerichtsbarkeit
Das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts war auch die Zeit des Aufstiegs der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. 44Eine eigentliche internationale Justiz mit festen Gerichten gab es damals noch nicht, die Unterwerfung unter «fremde» Institutionen erschien im Licht eines radikalisierten Souveränitätsverständnisses generell als Problem. Dennoch kam es zwischen 1872 und dem Ersten Weltkrieg zu mehreren Hundert Schiedsurteilen, bei denen die Abgrenzung zwischen politischer Vermittlung und Schiedsgerichtsbarkeit im juristisch-technischen Sinne noch nicht immer klar war. Teilweise amteten Staatspräsidenten oder ganze Regierungen als Schiedsrichter. Der Anteil der Juristen in den Schiedsgerichten stieg erst mit der Zeit allmählich an. Auffallend viele Schiedsfälle betrafen Grenzstreitigkeiten. So wurde etwa die Grenze Brasiliens vollständig von Schiedsgerichten festgelegt, was ihren zuweilen geometrischen Verlauf miterklärt. Auch politisch brisante Streitigkeiten wurden teilweise von Schiedsgerichten entschieden, was als grösster Fortschritt galt.
Hervorhebung verdient der Alabama-Schiedsfall von 1872. Er markiert im Wesentlichen den Beginn der modernen Schiedsgerichtsbarkeit. Es standen sich mit den Vereinigten Staaten und Grossbritannien zwei der damals mächtigsten Staaten gegenüber. 45Es ging um Neutralitätsfragen. Grossbritannien hatte sich im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 zunächst neutral erklärt und es dann aber doch zugelassen, dass auf seinem Territorium unter anderem ein Kreuzer der konföderierten Südstaaten gebaut wurde, die CSS Alabama. Das Schiff kam im Bürgerkrieg zum Einsatz und fügte den Unionstruppen starke Verluste zu. Das in Genf tagende Schiedsgericht kam zum Schluss, Grossbritannien habe seine Sorgfaltspflichten als Neutraler verletzt. Es verlieh mit seinem Entscheid dem nur dem Grundsatz nach feststehenden Neutralitätsrecht klarere Konturen. In der Sache hatte dies Elemente von Rechtsetzung durch Spruchtätigkeit. Der relative Erfolg der Schiedsgerichtsbarkeit in der Folge beflügelte den Glauben an die rechtsförmige Streitbeilegung. An den Haager Friedenskonferenzen war ihre Stärkung deshalb ein zentrales Thema. 1900 wurde auf Grundlage des 1899 angenommenen ersten Haager Abkommens zur friedlichen Beilegung internationaler Streitfälle der «Ständige Schiedshof» mit Sitz in Den Haag eingerichtet. Der Name verspricht mehr, als er hält, dennoch war der Schritt von einiger symbolischer Bedeutung. Er bestand und besteht bis heute im Wesentlichen aus einer Verwaltungsstelle, die bei der Einsetzung von Schiedsgerichten Hilfestellung leistet. Er hat in den letzten Jahren nach langem Schattendasein gar wieder an Bedeutung gewonnen.
Weg in den Ersten Weltkrieg
Die Frage, weshalb die internationale Ordnung mit dem Ersten Weltkrieg zusammenbrach, ist ein eigener Wissenschaftszweig. Man muss mit pauschalen Aussagen vorsichtig sein, zumal der Erste Weltkrieg sich bei näherer Betrachtung als Krieg mit drei Teilkriegen im Westen und Osten sowie auf dem Balkan darstellt. Trotz aller Zusammenhänge hatten diese zum grossen Teil eigene Hintergründe und Anlässe. Was man sicher sagen kann, ist, dass beim Zusammenbruch der Wiener Ordnung 1914 politische, militärische und kulturelle Faktoren auf komplexe Weise zusammenspielten. Seit der Jahrhundertwende gab es keine nichtkolonisierten Gebiete mehr. Koloniale Ambitionen – etwa jene des spät in den «Wettlauf» um die Kolonien eingetretenen Deutschen Reiches – mussten unweigerlich zu Spannungen mit anderen europäischen Grossmächten führen. In der Logik des Gleichgewichtsdenkens war das Zusammenrücken der späteren Alliierten gegen Deutschland das Naheliegende: gemeinsamer Selbstschutz gegen einen Staat, der mit der Deutschen Einigung 1871 die Gewichte zu seinen Gunsten verschoben und spät aggressiv koloniale Ambitionen entwickelt hatte. In deutschen Augen war das Zusammenrücken eine Bedrohung, ein Umzingeln, das in der deutschen Öffentlichkeit eine Art Paranoia erzeugte.
Das Völkerrecht war Teil des Ursachenbündels, das zum Ersten Weltkrieg führte. 46Völkerrechtler tun sich schwer damit, dies zu schreiben. Die Existenz eines «ius ad bellum» schien zu implizieren, dass Kriegführung etwas Normales oder gar Natürliches darstellt. Durch eine darwinistische Brille betrachtet – Darwins Denken wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts bekanntlich in vulgarisierter Form Gemeingut – war es Ausdruck einer Art Naturgesetzlichkeit. Damit trug das Völkerrecht mit zur Gewalt bei, es wurde in gewisser Weise selbst ein Opfer seiner eigenen Ambitionslosigkeit im Bereich zwischenstaatlicher Gewaltanwendung. Das «ius ad bellum» war im 17. Jahrhundert in einem sehr spezifischen Kontext entstanden, von dem es sich vollständig abgelöst hatte. Hinzu kam, dass das Völkerrecht keinerlei persönliche Verantwortlichkeit politischer oder militärischer Entscheidungsträger kannte. Es war ein Recht zwischen Staaten. Die Entscheidungsträger mussten somit nicht damit rechnen, für Kriege persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dieses «alte» Verständnis des Völkerrechts sollte mit dem Ersten Weltkrieg teilweise und mit dem Zweiten endgültig an sein Ende kommen. 47Man darf allerdings nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg in seinen Dimensionen ein Ereignis jenseits jeden Erwartungshorizonts war. Deutschland hatte ihn in der festen Überzeugung begonnen, es handle sich um einen kurzen Feldzug. Am Ende wurde er zu einem vierjährigen Krieg mit 17 Millionen Toten, der das Bild militärischer Gewalt für immer und auch das Völkerrecht fundamental veränderte. Man musste die Prämissen internationaler Politik neu denken.
Читать дальше