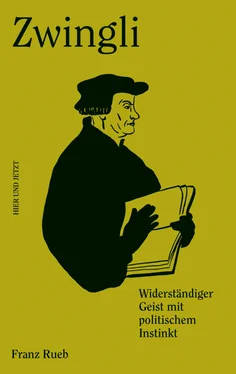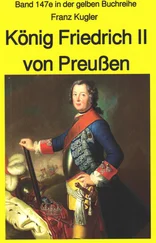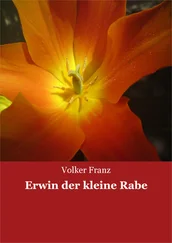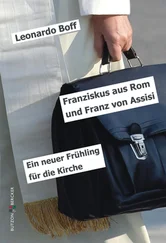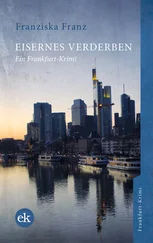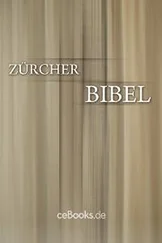Einige Male erwähnt Zwingli allerdings Naturkatastrophen, Verheerungen, meist als Metapher für politische Äusserungen und Verhaltensweisen in der Auseinandersetzung mit Gegnern. Er hat Wildwasserstürze erlebt, Berg- und Bachstürze, die auf den Alpweiden Verwüstungen anrichteten, Steine und Schutt mitführten und Weiden zerstörten. Oder er schilderte die gefürchtete Schneeblende oder Schneeblindheit, um die Verführung zu falschen Lehren symbolisch zu benennen und bildlich darzustellen. Der Junge hat grosses Getöse gehört, Steinklötze gesehen, wie sie mit den Bergrüfen mitgeschleppt wurden und Verwüstungen angerichtet haben, er hat mit angesehen, wie der sich stauende Strom die künstlichen Dämme durchbrach.
Schliesslich wurde der bald fünfjährige Knabe im Verlaufe des Jahres 1489 nach Weesen an den Walensee zum Onkel Bartholomäus Zwingli, einem Bruder des Vaters, gebracht. Ob es da tatsächlich eine Gemeindeschule gab oder ob der kleine Ulrich von seinem Onkel persönlich unterrichtet wurde, ist nicht bekannt. Ein Erlebnis wurde für den Jungen sicher der Walensee. Der Knabe wurde vor den Gefahren des Sees mehrmals ernsthaft gewarnt, offenbar ertranken immer wieder Kinder in dem nicht ganz zahmen See, was wir auch heute noch nachvollziehen können. Da wir so gar nichts wissen von Ulrichs Weesener Zeit, aber seinen weiteren Lebensweg kennen, darf man vermuten, dass es für den Jungen eine stille, sehr auf das Lernen konzentrierte Zeit gewesen sein muss.
Und 1494 wurde der zehnjährige Schüler nach Basel in die Rheinstadt gebracht, wo der mit der Familie Zwingli befreundete, noch sehr junge Gregor Bünzli, ein Sohn aus Weesen und mit Ulrichs Onkel gut bekannt, Lehrer war. Latein wurde gebüffelt, es wurde auf Teufel komm raus auswendig gelernt. Schüler durften oder mussten mit den Lehrern und untereinander ausschliesslich lateinisch reden. Hier wurde Ulrich in die lateinische klassische Literatur eingeführt, die ihm zeitlebens so wichtig und lieb war. In Basel lernte Ueli auch die Trivialfächer, also die Grundlagen des Triviums, die sogenannt unteren Fächer, nämlich Grammatik, Dialektik, Rhetorik.
Aber hier in Basel widmete sich der junge Zwingli ebenfalls intensiv und mit Leidenschaft dem musikalischen Handwerk. Basel war ein führender Platz in der humanistischen Harmonie- und Kompositionslehre. Die Dominikaner bemühten sich, den jungen Ulrich Zwingli ganz für die Musikpraktik im Kloster zu gewinnen. Sie unternahmen Anstrengungen, den musizierenden Scholaren zum Eintritt ins Kloster zu bewegen, wogegen Vater und Onkel Zwingli ihr Veto einlegten. Bei dieser Gelegenheit stellt sich die Frage, ob denn die Familie überhaupt klare Vorstellungen hatte, welchen Weg der Junge gehen sollte, ob sie einen Plan hatten, oder ob sie in erster Linie daran dachten, ihm die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Wohl wollten sie einen so hoffnungsvollen Filius nicht an ein Kloster verlieren, obgleich sie sicher nicht klosterfeindlich gesinnt waren. Die Ausübung der Musik jedenfalls, die in der humanistischen Bildung einen wichtigen Platz einnahm, hat denn von da an im ganzen Leben des Theologen und Reformators Zwingli immer eine zentrale und aktive Rolle gespielt. Da er der Musik mit theologischer Begründung in der Kirche, genauer im Gottesdienst, keinen Platz einräumte, hat das unzählige Zeitgenossen fast aller Zeiten dazu verleitet, aus Zwingli einen Musik-, ja einen Kunsthasser zu machen. Wir werden immer wieder einen Blick auf den Musiker Zwingli werfen dürfen oder müssen, denn er beherrschte mehrere Instrumente. Es gibt Biografen, die behaupten, Zwingli habe bis zu zehn Instrumente gespielt. Myconius, der Zwingli gut kannte, wohl auch mit ihm musiziert hatte, schrieb: «In der Musik zeichnete er sich weit über sein Alter aus, wie dies bei Kunstfertigen die Regel ist.» Und Johannes Stumpf, ein ebenfalls früher Biograf, hält fest, Zwingli sei auf allen Instrumenten unterrichtet gewesen: auf der Harfe, der Laute, der Geige, der Flöte, dem Waldhorn, dem Zink, den Pfeifen und dem Hackbrett. Jedenfalls war er fähig zu komponieren. Er wäre wohl sogar in der Lage gewesen, einen Kantorenposten zu übernehmen und auszufüllen; Kantoren mussten ja zu einem Teil auch Theologen sein.
Nun kam der inzwischen zwölfjährige Scholar nach Bern, und zwar dort zu dem bereits bekannten, wenn nicht sogar berühmten Humanisten Heinrich Wölfflin, mit lateinischem Namen Lupulus. Ziel war die Reife für die Universität. Man las die Poesie der alten Klassiker, eine Lieblingsbeschäftigung des jungen Zwingli. Und wiederum warfen auch hier die Dominikaner und der bekannte Komponist und Münsterkantor Bartholomäus Frank einen begehrlichen Blick auf den Schüler mit den musikalischen Fähigkeiten und der auffallend schönen Singstimme. Und wieder mussten Vater und Onkel eingreifen, um ihn vor dem Eintritt in das Novizenzentum des Ordens zu bewahren.
Interessant ist, dass der junge Zwingli in Bern wahrscheinlich mit dem späteren Maler, Künstler und Ratsherrn Niklaus Manuel Deutsch die Schulbank drückte. Die beiden werden sich später ganz sicher im Rahmen des reformatorischen Prozesses öfters begegnet sein, kamen sich aber nie wirklich nahe. Niklaus Manuel wurde zwar ein Anhänger der Zwinglischen Reformation, ein bedeutender Künstler, er schuf gewichtige Werke, besonders den Berner Totentanz, jenes Riesenwerk von 80 Meter Länge, oder 24 Tafeln, jenen gewaltigen Zyklus, der einen bedeutenden Platz in der Kunstgeschichte einnimmt.
Von Bedeutung ist ausserdem, dass der Künstler Niklaus Manuel Deutsch in Bern fünf Jahre Landvogt und zwei Jahre Ratsherr war. Er war ein Führer der reformatorischen Partei, vertrat eine eidgenössische Friedenspolitik, am Ende aber als eigentlicher Gegenspieler Zwinglis, vor allem, da er ein Befürworter der Pensionen war. Darüber hinaus wissen wir über die Berner Zeit des jungen Zwingli fast nichts.
Nach nur zwei Jahren in Bern erlangte der junge Zwingli erstaunlicherweise bereits die Reife für die Universität. Noch im Herbst 1498 hat er sich an der Universität Wien immatrikuliert; die Einschreibung liegt vor, sein gewollter Eintritt ins Studium ist belegt. Er war noch nicht ganz 15-jährig, ein Rätsel im Rahmen unserer heutigen Bildungsvorstellungen. Sicher ist er zu Fuss nach Wien marschiert oder gewandert, mindestens zwei bis drei Wochen wird er unterwegs gewesen sein, vermutlich in Begleitung von anderen jungen zukünftigen Akademikern, denn die Wiener Universität wurde von mehreren Schweizern aufgesucht. Was heute ein unvorstellbarer Gewaltsmarsch wäre, galt in jener Zeit als nicht aussergewöhnlich.
In Wien gab es anscheinend an der Universität Probleme, denn Zwinglis Eintragung «Udalricus Zwingly de Glaris» ist durchgestrichen, daneben steht mit fremder Handschrift «exclusus». Dieser Umstand hat in der Geschichtsschreibung grossen Rumor ausgelöst und einige Autoren zu feindseligen Spekulationen verleitet. Es ist nie bekannt geworden, was vorgefallen war, was der Grund war für den Ausschluss, ob wirklich ein solcher stattgefunden hat. Es gibt die Vermutung, diese Eintragung sei ein paar Jahrzehnte später, wohl am ehesten in der Zeit der Gegenreformation, von einem Fanatiker neben den Namen des Ketzers gesetzt worden. Auch Zwingli hat sich später nie dazu geäussert, konnte wohl gar nicht, sollte diese Eintragung neueren Datums gewesen sein. Oder war ihm die Episode zu unbedeutend, war sie ihm vielleicht unangenehm? Es wird vermutet, der junge Schweizer sei in eine studentische Rauferei verwickelt gewesen, denn es ist zu bedenken, dass es die Zeit des Schwabenkriegs war.
Vielleicht sind deutsche und schweizerische Studenten aufeinandergeprallt. Vermutlich ist er zu Fuss ebenso selbstverständlich wieder zurückgewandert in die Schweiz. Aber auch darüber wissen wir nichts Genaues. Anderthalb Jahre später, im Sommersemester 1500, findet sich die zweite Immatrikulation, diesmal folgendermassen: «Udalricus Zwingling de Lichtensteig im Toggenburg». Der Grund für den Ausschluss im Herbst 1498 konnte also nicht allzu gravierend gewesen sein. Seltsamerweise kommt kaum ein Kommentator auf diese Konklusion zu sprechen. Und zudem fällt auf, wie Oskar Farner sagt, dass der Vermerk und die in solchem Falle übliche Notiz «reincorporatus» oder «reinclusus» für wieder Aufgenommene in den Hochschulverband fehlt. Farner stellt auch fest, dass kein einziger Zeitgenosse von dem Vorfall Kenntnis hatte. Zwingli war hochprominent, als «Ketzer» einer der bestgehassten Existenzen der Zeit, es wäre doch höchst verwunderlich, wenn seine Feinde, wäre denn hier ein ernstzunehmendes Fehlverhalten Zwinglis nachzuweisen, davon niemals Gebrauch gemacht hätten. Der Erste, der diese «Exclusus»-Geschichte entdeckt und in Umlauf gebracht hatte, war der Abt von Einsiedeln in der Zeit der Gegenreformation ein halbes Jahrhundert nach Zwinglis Tod. Von da an wurde sie unermüdlich nacherzählt, aber nie nachgeprüft.
Читать дальше