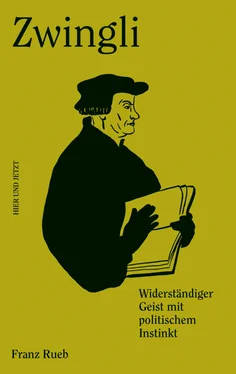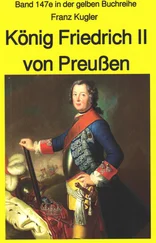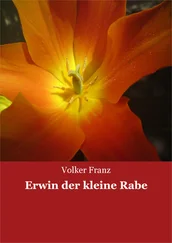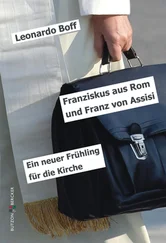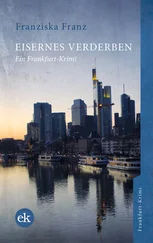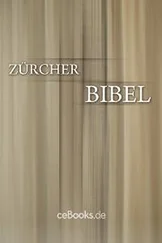Die jungen Männer in der freien Schweiz waren so frei, das Interesse für eintönige Handels- und Gewerbetätigkeit oder die Feldarbeit zu verlieren und von sich zu weisen, sie fanden keinen Gefallen mehr an den bescheidenen, engen Verhältnissen in den Bergtälern der Innerschweiz, am langweiligen Handwerk oder an der Scholle hinter dem Wald. Unter diesen Bedingungen spross ein zynisches Verhältnis zum Vaterland, zur gebremsten und fehlgeleiteten Entwicklung des eigenen Landes, besonders bei denen, die gross mit dem Vaterland prahlten. Diese Entwicklung spürte der Student Zwingli und später noch verschärft der junge Priester auf dem Land schmerzlich. Man kam und ging, wie es gerade passte, man warf mit dem Geld um sich, das man mit dem Kriegshandwerk in fremden Diensten verdient hatte, man haute die geplünderte Beute auf den Kopf, egal, ob man ein körperlicher oder seelischer Krüppel war. So wurde der Reislauf (der Eintritt in fremden Dienst als Söldner) zum Hauptübel der Gesellschaft, und er beschleunigte die wirtschaftliche, soziale, politische wie moralischsittliche Verluderung. Dies ist nicht nur die Deutung Zwinglis und seiner Mitstreiter. Mehrmals, bereits einige Jahre vor Zwingli, wurden die sogenannten Blutsverkäufer bekämpft, die Reisläuferei wurde verboten und strengere Sittenmandate erlassen; die Verbote wurden nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen. Das war überhaupt ein wichtiges Kennzeichen der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Vor-Zwingli-Zeit: Sittenmandate wurden immer und immer wieder erlassen, aber sie wurden kaum befolgt. Die Obrigkeit konnte sich nicht durchsetzen, was sich übel auswirkte auf das Gemeinwesen und somit auf die Gesellschaft der damaligen Zeit. Die sittliche Lage war katastrophal.
Ganze Stadt- und Staatshaushalte, vor allem in den inneren Orten, waren von den fremden Pensionen abhängig. Der französische König zahlte weitgehend die «Betriebskosten» dieser Gemeinwesen. Rom zahlte den Priestern bescheidene Unterstützungsgelder, um sie an das Papsttum zu binden. Von den unermesslichen Reichtümern, welche überall aus dem Volk herausgepresst und nach Rom abtransportiert wurden, verteilte man ein paar Gulden an die kirchlichen Statthalter, die dafür zu sorgen hatten, dass die römische Kirche im Dorf blieb.
Soldverträge und Reislaufen kamen der Allgemeinheit wirtschaftlich kurzfristig zugute, mochten die Schäden sonst noch so bedenklich ins Gewicht fallen. Die Gesellschaft war im gefährlichen Würgegriff «konformer Korruption» auf sämtlichen Gebieten. Die kirchlichen und behördlichen Missstände waren den ohnmächtigen Räten längst entglitten. Die Obrigkeit begann, kirchliche Befugnisse an sich zu reissen.
Man wollte zwar keinen Bruch mit dem Alten, man wollte behutsame Änderungen, unter eigener Regie. Die erwachte Zürcher Bürgerschaft wollte aus der Auslandsabhängigkeit herauskommen. Das ging nur, wenn es gelang, das eigene wirtschaftliche Potenzial zu entwickeln und zu stärken. Man wollte nicht mehr die eigene Haut oder das eigene Blut, dafür mehr eigene handwerkliche Artikel auf die internationalen Märkte tragen. Gegner dieses politökonomischen Willens der Handwerkermeister und Kaufleute in der Zünfterstadt Zürich waren die inländischen Kriegsdienstherren, und zwar, und das ist wichtig, lange vor der Reformation und vor Prediger Zwingli. Es fehlten Arbeitskräfte, weil die jungen Männer scharenweise auszogen auf die Schlachtfelder Europas. Die Lohnforderungen zu Hause stiegen, da die Männer im Waffendienst besser entlöhnt und zudem korrumpiert wurden durch die Möglichkeit, sich an brutalen Beutezügen zu beteiligen. Das Gemeinwesen zu Hause verrottete. Der Gegensatz zum Klerus und zum Adel wurde schärfer, zu gerne hätte man beide abgeschüttelt. Das Selbstbewusstsein der Gewerbetreibenden stieg. So wurden die Zürcher Zunftherren, die im Grossen Rat sassen, durch ihre wirtschaftspolitischen Interessen zu Gegnern des Solddienstes. Und ihr zentrales Bestreben war die Emanzipation von Papst, König und Kaiser, vor allem die Eindämmung der Macht und des Einflusses der römischen Kurie.
Das waren die Voraussetzungen dafür, dass dieser humanistisch gebildete Toggenburger Leutpriester, der in Einsiedeln durch seine evangelischen und antipapistischen Predigten von sich reden gemacht hatte, von den Zünftern und Räten nach Zürich geholt wurde. Er sollte die Emanzipationsbewegung der republikanischen Stadtgemeinschaft aus der bischöflichen Oberhoheit religiös und ideologisch untermauern und befördern. Der Mann ging mit einem solchen Schwung und mit solcher Radikalität zu Werke, dass die Bürger gezwungen waren, mitzuziehen.
Zwingli wird schon als Kind auch in seinem Tal die Beobachtung und die Erfahrung gemacht haben, dass junge Männer auf die Kriegsschauplätze zogen. Er wuchs damit auf, dass manche nie mehr nach Hause kamen. In seiner Familie wurde dieser für das Tal oft schlimme Aderlass wahrscheinlich besprochen. Seine Familie machte in diesem Geschäft mit eigenem Blut vorerst nicht mit. Aber die Landwirte unter seinen Brüdern liebäugelten immer wieder mit dieser Möglichkeit. Ulrich wuchs aber auch mit der sittlichen Verluderung in der Gesellschaft auf, er sah, wie die Mönche und Priester ganz selbstverständlich gegen alle sittlichen Regeln lebten, sich Mätressen hielten, in eheähnlichen Verhältnissen durch den Alltag gingen. Man kann natürlich sagen, dass dieser junge Mann von den gesellschaftlichen Zuständen geformt wurde. Und dieser Vorgang hielt an, radikalisierte sich, verfeinerte sich wiederum, aber blieb bei Zwingli eine Basis, die ihn nicht mehr losliess.
Es gibt von Ulrich Zwingli später eine Äusserung, dass seine Brüder nicht immer gefeit waren gegen die Verlockungen des fremden Solddienstes. Der Vater Zwingli wird in Wildhaus und im Thurtal den Kampf gegen den Solddienst geführt haben. Die Profiteure dieser Blutsverkäufe an die ausländischen Mächte argumentierten heuchlerisch mit dem europäischen Ruf nach den begehrten Schweizer Kämpfern durch die berühmten erfolgreichen Freiheitskriege des Bauernvolkes, übrigens auch jener des Toggenburgs gegen die Ansprüche des Abtes von St. Gallen. Aber diese Herleitung und Begründung eines miesen Geschäftes konnte man nicht gelten lassen. Der Solddienst war ja nicht allein moralisch verwerflich, er war auch wirtschaftlich schädlich, denn die jungen Männer verkauften sich an die fremden Herren und schlugen deren Schlachten, während sie zu Hause auf dem Arbeitsmarkt fehlten. Natürlich gab es auch Söldner, über deren Abwesenheit im Land viele froh waren. Denn nicht für alle gab es einen Platz und vor allem für viele keine Arbeit. Der Solddienst war also auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Der kleine Junge Ueli wuchs in einer Gemeinschaft auf, in welcher die politische Aktivität fast naturgegeben war, in der Bischof, Kaiser, König weit weg waren, wo man keinem direkten Oberhaupt zu gehorchen hatte, in der es kaum ein Reichsbewusstsein gab, obwohl die eidgenössischen Orte nominell zum Heiligen Römischen Reich gehörten. Ueli hat als Jugendlicher aus der Entfernung den Schwabenkrieg erlebt. Aber vordergründig und bewusstseinsgestaltend war für ihn die Zugehörigkeit zur freien Eidgenossenschaft und zu einer freien Talschaft. Das war prägend für den jungen Zwingli, und das wurde tragend und bestimmend im republikanischen Politiker Zwingli. Politische Betätigung wurde quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Wer sich an den alltagspolitischen Prozessen nicht beteiligte, der wurde überfahren, die ehrenamtliche Verantwortung und Betätigung für das Gemeinwesen wurde früh geübt und führte ganz natürlich zu einem republikanischen Geist.
Der allererste Biograf, der Zeitgenosse und enge Mitarbeiter Zwinglis, der Humanist Myconius, der ihn überlebte, erwähnt übrigens den Einfluss der Bergwelt auf den späteren Reformator, ihre Schönheit und Gewalt und Kraft und «Erhabenheit». Dies habe ihn dem Himmel nähergebracht, vermutet Myconius idealisierend. Von Zwingli selbst gibt es nirgends eine Äusserung zur Bergnatur in seiner Jugend, wohl aber mehrere stolze Erwähnungen der Tatsache, dass er aus dem Bauernstand gewachsen ist. Noch ist im 16. Jahrhundert die freundlich-romantische Anschauung des Gebirges fremd, wohl wurde der Säntis weniger als Freund, schon gar nicht als zu eroberndes, zu besteigendes Massiv, sondern eher als Bedrohung und Gefahr erlebt. Die Äusserung von Myconius ist also erstaunlich erfinderisch.
Читать дальше