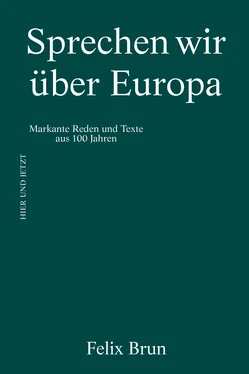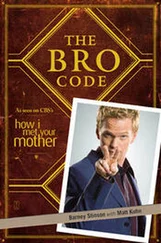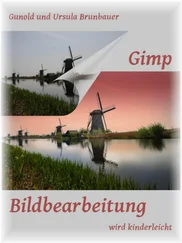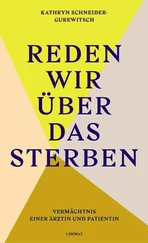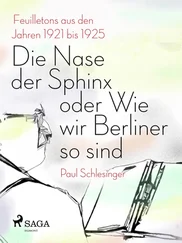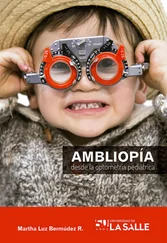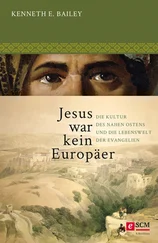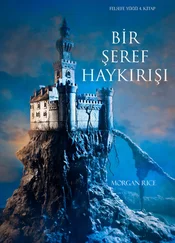Europa und die versammelten Autoren erlebten in verschiedenen Kriegen immer wieder, was geschieht, wenn das Trennende stärker wird als das Verbindende. Wenn die «Krankheit des Nationalismus», so Hans Bauer, überhandnimmt, dann ist auch die kleine, neutrale Schweiz betroffen und bedroht. Das ist die dritte Thematik dieses Buches: das Gefühl der Verwundbarkeit in der Schweiz, das Wissen um die Abhängigkeit vom Goodwill unserer grossen Nachbarnationen. Damit verbunden ist der Reflex der Ablehnung, der Wille zur Isolation, der Gedanke, dass man von den grossen Ereignissen in der Welt am liebsten in Ruhe gelassen werden möchte. Was die zehn hier vorgestellten Persönlichkeiten in diesem Punkt verbindet, ist ihre konsequente Ablehnung dieser Idee. Sie sehen in der Isolation eine grosse Gefahr, der nur über eine Verbindung mit Europa entgegnet werden kann. Für diese Verbindung muss eingetreten werden, auch wenn die europäischen Nachbarn Fehler machen. Zusammenarbeit ist offensichtlich fruchtbarer – und letztlich sicherer – als Ablehnung und Isolation. Wenn wir also, wie ich das bis vor wenigen Jahren ebenfalls getan habe, Europa verachten für seine Fehler, für sein Demokratiedefizit etwa oder für seine Haltung an der Grenze im Mittelmeer, so ist es durchaus möglich, dass wir das aus einer unbewussten Angst tun, einer Art «Unbehagen im Kleinstaat», wie Karl Schmid es nennt. Die Angst also der verwundbaren, aber bislang verschont gebliebenen Schweiz in Europa: die Angst vor übergreifendem Zentralismus und Rationalismus, die Angst vor dem Befehl, die Angst vor dem Recht des Stärkeren, die Angst davor, dass der Vielfalt und damit der europäischen Aufklärung enge Grenzen gesetzt werden. Alle zehn Autorinnen und Autoren begegnen dieser Angst mit der Aufforderung nach mehr Zusammenarbeit, nicht nach mehr Abgrenzung.
Es heisst manchmal, es mangle der Schweiz an starken Persönlichkeiten. Diese Schelte widerlegen die zehn Denkerinnen und Denker. Über einen Zeitraum von 100 Jahren setzten sie sich vor dem jeweiligen zeithistorischen Hintergrund intensiv mit dem Verhältnis der Schweiz zu Europa auseinander. In einem Essay werden jeweils die Person und ihr biografischer Hintergrund beleuchtet. Es findet eine Einordnung statt, wann, weshalb und wo die nachfolgende Quelle publiziert oder die Rede gehalten wurde, allenfalls auch, welche Resonanz das Gesagte hatte. Die zehn Personen zeichnet Folgendes aus: Sie blicken kritisch auf Europa, sie suchen nach neuen Lösungen, sie stellen sich Fragen, sie sprechen über die Schweiz und Europa, sie befassen sich aktiv mit dieser Beziehung und widerstehen einer passiven Ablehnung. Die Reihenfolge der Texte ist chronologisch. Begonnen wird in der Gegenwart mit einem Text von Gret Haller aus dem Jahr 2018, den Schluss bildet eine Rede von Bundespräsident Felix Ludwig Calonder von 1918 zur Frage des Völkerbunds. Diese Reihung, dieser Blick zurück von den heutigen Debatten und Herausforderungen auf die damaligen Auseinandersetzungen, zeigt die verblüffende Aktualität der Reden. Damit erschliesst sich die zeithistorische Dimension über den weiten Bogen, der über «100 Jahre Nachdenken über die Schweiz und Europa» geschlagen wird.
Diese Arbeit hat mir klar vor Augen geführt, dass die Schweiz in der heutigen, globalisierten Welt im Alleingang nur verlieren, in der Zusammenarbeit mit Europa aber gewinnen kann. Dieser Gewinn sollte gegenseitig sein, so selbstbewusst darf die Schweiz durchaus sein. Und so selbstbewusst haben es auch viele Rednerinnen und Redner in diesem Buch formuliert. Sprechen wir über Europa und beziehen dabei ein, was dazu in den vergangenen 100 Jahren gedacht und gesagt wurde, so eröffnen sich neue Perspektiven, und die Zukunft gewinnt an Schärfe.

Die Politikerin und Anwältin Gret Haller setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass die künstlich geschaffene Ordnung in eine «äussere», und damit «männliche», und in eine «innere», «weibliche» Welt überwunden wird. Eisern hat sie während ihres gesamten Lebens an den Prinzipien der Offenheit, der Gleichheit und der Zukunftsorientierung festgehalten und findet so in ihrem neuesten Buch über Europa zur Geburt des weltoffenen und dialogbereiten «Europabürgers».
2018: Zahlreiche Krisen halten Europa in einer sonderbaren Lähmung gefangen. Es fehlt an Ideen. Da ist wohl ein Emmanuel Macron, der mit seiner Bewegung «En Marche» für ein progressives Europa einsteht. Doch mag man vor dem Hintergrund der aktuellen Protestwelle wirklich an eine Veränderung glauben? Glatt wirkt der französische Präsident, zu nah bewegt er sich an den elitären Kreisen der Pariser Wirtschaft und des Militärs. In Deutschland bleibt Kanzlerin Angela Merkel seit Jahren matt und lässt sich von der bayerischen CSU drangsalieren. Begleitet von grossen Friktionen verabschieden sich Theresa May und Grossbritannien aus der EU. Die Visionen werden aus der Vergangenheit entlehnt: Man spricht wieder von der «Nation» als Körper einer ethnischen Gemeinschaft. Man ruft wieder «Deutschland den Deutschen» oder «Ausländer raus».
Gret Haller, Ehrendoktorin der Universität St. Gallen, formuliert einen Zukunftsentwurf für Europa: Sie sieht in der europäischen Integration das Entstehen einer neuen Form von «Staatlichkeit», im Sinne einer staatspolitischen Identität, einer Gleichheit, die über den Begriff der Nation hinausgeht. Wie lassen sich diese Überlegungen politisch vermitteln? Wie kann sich ein politischer Wille entfalten?
Wer mit Gret Haller das persönliche Gespräch sucht, wird schnell mitgerissen von ihrem Tatendrang und ihrer Lust am Widerstand, am Widerstreit. Man merkt: Diese Frau sucht die Auseinandersetzung. Nicht die schlichte Provokation. Die offene Auseinandersetzung auf Augenhöhe, mit Respekt für die Meinung des Gegenübers. Gleichheit, wie sie die Französische Revolution forderte, ist der zentrale Begriff im Denken und Handeln Gret Hallers, und er war der Ausgangspunkt und die Leitlinie ihrer juristisch-politischen Tätigkeit. Ihr Lebensweg ist für eine Schweizerin aussergewöhnlich – ihre Laufbahn äusserst erfolgreich, sie führte sie bis weit nach Europa.
Im Alter von 25 Jahren reicht Gret Haller in Zürich ihre Doktorarbeit zur Stellung der Schweizer Frau verglichen mit den UNO-Menschenrechtskonventionen ein. Sie benennt darin die Diskriminierung der Frau als eine Folge der Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern. «Innerhäusliche Aufgaben» sind der Frau zugewiesen, während dem Mann die Aufgabe des Ernährers und andere «ausserhäusliche Aufgaben» 1zufallen. Das Risiko für beide Parteien, also für den Mann und die Frau, aus den herrschenden Rollenbildern auszubrechen, sei nur schon finanziell sehr hoch. Zudem sei die Vorstellung verbreitet, dass die Frau eine höhere Bildung nicht nötig habe, da sie sich in der Ehe in erster Linie um den Haushalt zu kümmern habe und nicht um ihre beruflichen Möglichkeiten. Die Diskriminierung der Frau in der schweizerischen Gesellschaft lässt sich laut Gret Haller folglich nur beheben, wenn «das Familienrecht beiden Ehegatten grundsätzlich zu gleichen Teilen die Verantwortung für den Familienunterhalt, die Kinderbetreuung und die Haushaltführung auferlegt». 2Gleichheit bedeutet für Gret Haller also erst einmal, die privaten und gesellschaftlichen Verantwortungen – und damit auch Entlohnung und Anerkennung – gleich aufzuteilen. Ist die familiäre Verantwortung egalitär auf die Schultern der Frau und des Mannes verteilt, so wird sich auch die übrige Gleichstellung ergeben, ist Haller überzeugt: Die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger würden diese Entflechtung der klaren Rollenverteilung in der Familie früher oder später auch in ihren Tätigkeitsbereichen übernehmen müssen.
Читать дальше