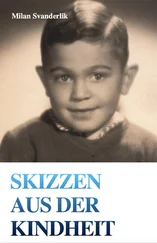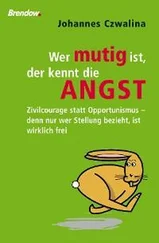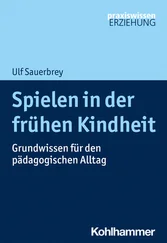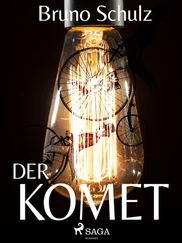Diese Beispiele illustrieren die zwei Funktionen, die der menschliche Nachahmungsdrang hat: die Lernfunktion und eine soziale Bindungsfunktion (vgl. Užgiris 1981). Das Nachahmungslernen ist die Basis dafür, dass sich Menschen in einer Kultur auf ähnliche Weise verhalten, sich kulturübliche Gewohnheiten herausbilden – und Kinder darin hineinwachsen (vgl. Tomasello 2011). Darüber hinaus stärkt das Nachahmen die sozialen Bande zwischen Menschen. Insbesondere Sympathie und prosoziales Verhalten werden durch Nachahmung erhöht (vgl. Duffy & Chartrand 2015; Over & Carpenter 2012). Beide Funktionen können im pädagogischen Alltag in der Frühförderung genutzt werden. Die Rede vom guten Vorbild ist Eltern und Pädagoginnen bzw. Pädagogen eingängig. Weniger verbreitet ist bisher das Wissen, dass Nachahmung nicht nur das Lernen unterstützt, sondern auch das soziale Miteinander verbessert.
3DIE BIOLOGISCHE BASIS DES KINDLICHEN NACHAHMUNGSLERNENS
Die biologisch-neurologische Grundlage für das Nachahmen von Handlungen sind wahrscheinlich Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind Nervenzellen im Gehirn, die sowohl bei der Handlungswahrnehmung als auch bei der Handlungsausführung aktiviert sind (vgl. Di Pellegrino et al. 1992). Es wird vermutet, dass diese Zellen bei der Beobachtung einer Handlung motorische Zellen aktivieren und so die Nachahmung der Handlung unterstützen oder vorbereiten. Gesicherte Belege für diese Vermutung gibt es jedoch bisher nicht.
Die aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass Spiegelneuronen ihre Funktion »lernen«. Interessant dabei ist, wie das geschieht. Es zeigt sich nämlich, dass es dabei essenziell sein könnte, selbst nachgeahmt zu werden (vgl. Cook et al. 2014). Spiegelneuronen entwickeln ihre Funktion dadurch, dass ein Individuum die eigene (aktuell ausgeführte) Handlung zeitgleich oder extrem zeitnah bei einem anderen Individuum beobachtet. Gelegenheit dafür gibt es, wenn die eigene Handlung von anderen nachgeahmt wird. Es ist gut möglich, dass sich so Spiegelneuronen im kindlichen Gehirn bilden, denn Beobachtungsstudien zeigen, dass Eltern die Bewegungen und Laute ihrer Kleinkinder sehr häufig nachahmen (vgl. z. B. Masur & Rodemaker 1999).
4WAS UND WEN AHMEN KINDER BESONDERS STARK NACH? WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNGEN UND PRAKTISCHE TIPPS ZUM NACHAHMUNGSVERHALTEN BEI KLEINKINDERN
Kinder ahmen alles nach. Das gehört zur Alltagserfahrung von Eltern und Pädagogen bzw. Pädagoginnen. Besonders schnell scheinen Kinder die Dinge aufzuschnappen, von denen sich Erwachsene wünschen, sie würden sie niemals erlernen – sei es, jemandem einen Klaps auf den Po zu geben, ständig am iPad zu hängen oder Schimpfwörter zu verwenden. Wie kommt das? Und worauf müssen Pädagoginnen bzw. Pädagogen achten, wenn sie den kindlichen Nachahmungsdrang zum Vorteil für die Entwicklung der Kinder nutzen wollen?
Um zu verstehen, wie Kinder Handlungen (vom Dankesagen über Händewaschen, Holzsägen und Kuchenbacken bis zum Abschiedswinken) erwerben, braucht es zunächst etwas Theorie darüber, was Handlungen eigentlich sind. Also: Handlungen sind zielgerichtete Bewegungen. Die Bewegungen (die je nachdem mit oder ohne Werkzeuge ausgeführt werden) werden Handlungsmittel genannt. Die Handlungsmittel dienen dem Erreichen bestimmter Handlungsziele. Zum Beispiel kann das Ziel »Durst löschen« durch Trinken erreicht werden – die exakten Trink-Handlungsmittel unterscheiden sich jedoch je nach Getränk, dem Behälter, in dem sich das Getränk befindet, und dem kulturellen Kontext, in dem das Trinken stattfindet. Analog kann das Ziel »schnell an einen anderen Ort (z. B. an einen Spielplatz oder Tierpark) zu gelangen« mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden. Die exakten Handlungsmittel unterscheiden sich dabei nach der eigenen Position und der Distanz zum Ziel: Zum Beispiel kann man mittels schnellen Gehens oder mittels Velofahrens an den Zielort gelangen – je nach Entfernung und Fähigkeiten kommen eventuell auch Autofahren, Motorradfahren oder Zugfahren infrage. Eine derart große Auswahl von Handlungsmitteln zur Zielerreichung ist sehr oft vorhanden.
Bei der Paarung von einem Handlungsmittel und einem Handlungsziel wird in der Handlungstheorie von einer Mittel-Zweck-Relation gesprochen. Einige Mittel-Zweck-Relationen zeichnen sich durch besondere Effizienz aus. Zum Beispiel ist »löffeln« ein wesentlich effizienteres Handlungsmittel, um das Ziel »eine Suppe essen« zu verwirklichen, als »gabeln«. Andere Mittel-Zweck-Relationen sind Konventionen. Zum Beispiel ist es eine Konvention, welche Handlungsmittel (Werkzeuge) Erwachsene zum Verspeisen fester Nahrung verwenden. Die Effizienz von Stäbchen, Messer und Gabel oder Händen unterscheidet sich nicht – vorausgesetzt der Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen wird gleichermaßen beherrscht. Ob das eine oder das andere Handlungsmittel gewählt wird, ist lediglich eine kulturspezifische Konvention.
Dieser knappe theoretische Einblick in die Handlungstheorie zeigt, dass Kinder beim Erlernen von Handlungen eine Vielzahl verschiedener Aspekte beachten müssen. Insbesondere kommt es beim Erlernen von Handlungen darauf an, zu erkennen, welches Handlungsziel mit welchen Handlungsmitteln verfolgt und erreicht werden kann. Dies ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Das Beispiel im Kasten soll illustrieren, dass sich selbst eine einfache Handlung, wie das Benutzen eines Regenschirms, bei genauerer Analyse als recht komplexer Vorgang – mit vielen Teilhandlungen, die jeweils Teilziele haben, die einzelne Handlungsmittel erfordern – herausstellt (siehe Kasten).
Das Benutzen eines Regenschirms zerfällt in mindestens drei Einzelhandlungen: Regenschirm nehmen, Regenschirm aufspannen und Regenschirm tragen. Voraussetzungen zum sinnvollen und erfolgreichen Nutzen eines Regenschirms sind: 1.die relevanten motorischen Fähigkeiten, um die Handlungsmittel »Greifen«, »Halten« und »Aufspannen des Regenschirms« ausführen zu können 2.Wissen um die Zweck-Mittel-Relationen der Einzelhandlungen 3.die Fähigkeit, Situationen zu erkennen, in denen die Anwendung dieser Zweck-Mittel-Relation angezeigt ist (weniger abstrakt ausgedrückt: Es muss erkannt werden, dass es regnet) 4.Wissen, dass Regen nass macht und daher das Ziel »Trockenbleiben« besondere Maßnahmen erfordert – sofern das Haus oder einen Unterstand verlassen wird 5.Wissen, dass man unter dem Regenschirm einigermaßen trocken bleibt  Foto: FamVeld/iStock Foto: FamVeld/iStock |
4.2WAS AHMEN KINDER NACH?
Die Alltagserfahrung, dass Kinder alles nachahmen, kann und muss im Lichte der Forschung etwas relativiert werden. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welche Handlungsaspekte Kinder bei der Nachahmung besonders beachten und wie Erwachsene Sprache nutzen können, um das Nachahmungsverhalten bei Kindern zu steuern.
Soll ein Kind dazu gebracht werden, etwas nachzuahmen, kann seine Aufmerksamkeit und Nachahmungsbereitschaft durch direktes Ansprechen und den Gebrauch von kindgerichteter Sprache erhöht werden. Beides signalisiert Kindern: »Jetzt gibt es etwas zu lernen« (vgl. Király, Csibra & Gergely 2013). Kinder ahmen aber auch aus eigenem Antrieb nach. Zum Beispiel sind Interesse an den Handlungen anderer und Nachahmungsbereitschaft bei Kindern erhöht, die selbst erfolglos versucht haben, ein bestimmtes Ziel zu erreichen (vgl. Williamson, Meltzoff & Markman 2008). Dies ist ein interessanter Anknüpfungspunkt, um Nachahmungslernen in der Elementarbildung auch in solchen Einrichtungen zu integrieren, in denen auf eigenständiges entdeckendes Lernen gesetzt wird.
Читать дальше
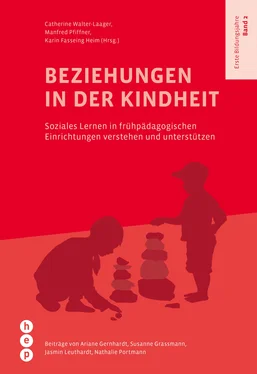
 Foto: FamVeld/iStock
Foto: FamVeld/iStock