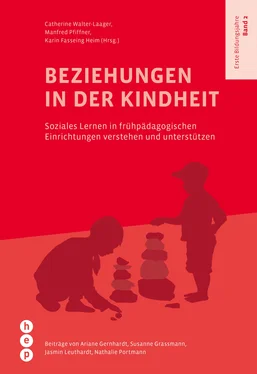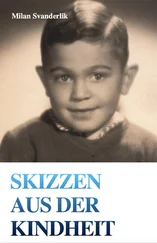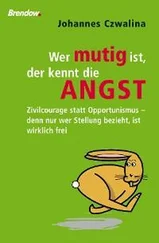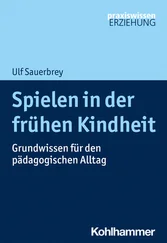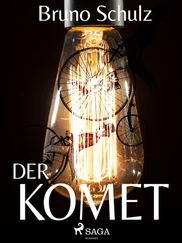Persönliche Vertrauenstheorien sind sehr individuell ausgeprägt. Daher akzentuieren verschiedene Menschen unterschiedliche Merkmale, um zu einem Vis-à-vis Vertrauen fassen zu können. Fünf Faktoren sind für die Vertrauensbeziehungen in institutionellen Kontexten aber zentral:
•Persönliche Zuwendung
•Fachliche Kompetenz und Hilfe
•Respekt
•Zugänglichkeit
•Aufrichtigkeit (vgl. ebd.)
Die Faktoren, die Kinder in Vertrauensbeziehungen erleben, decken sich an vielen Stellen mit denjenigen, die Kinder in positiven Bindungen erfahren:
•Zuwendung: Dieser Punkt ist positiv ausgeprägt, wenn zwischen dem Kind und der Pädagogin oder dem Pädagogen eine liebevolle und emotional warme Kommunikation besteht.
•Sicherheit: Das Gefühl von Sicherheit vermittelt eine Bezugsperson, indem sie auch bei eigenaktiven Tätigkeiten des Kindes verfügbar bleibt.
•Erkundung: Wenn die Fachperson das Kind bei neuen Erkundungen unterstützt, spricht man von Explorationsunterstützung.
•Unterstützung und Information: Bei schwierigen Aufgaben braucht das Kind Unterstützung oder zusätzliche Informationen. Die Pädagogin oder der Pädagoge assistiert (vgl. Ahnert 2007; Ahnert & Gappa 2010).
Schweer und Padberg (2002) heben die notwendige fachliche Kompetenz für Vertrauensbeziehungen in institutionellen Kontexten wie bspw. der Schule deutlich heraus und benennen den Punkt der Aufrichtigkeit zusätzlich. Der letztgenannte Aspekt ist aber auch bei Bindungsbeziehungen von Bedeutung, da nur bei einer aufrichtigen Beziehung auch Verlässlichkeit für das Kind möglich wird.
5AUSWIRKUNGEN DER SOZIALEN BEZIEHUNGEN IM INSTITUTIONELLEN KONTEXT
Soziale Beziehungen in Einrichtungen sind durch institutionelle Rahmenbedingungen geprägt. Die Pädagoginnen und Pädagogen verpflichten ihre Lernenden zur Übernahme ihrer Rolle als Krippenkinder oder als Kindergarten- bzw. Schulkinder. Die Kinder haben sich den institutionellen Gegebenheiten anzupassen (vgl. Böhnisch 1996). Im Gegensatz dazu engagieren sich nicht alle Pädagogen und Pädagoginnen im Beziehungsaufbau zu den Kindern (vgl. zusammenfassend Gutknecht 2015) und es stehen den Fachpersonen mehrere Möglichkeiten offen, diese Zwangsgemeinschaft aus eigener Kraft und damit einseitig aufzulösen. Beispielsweise können Kinder und später auch Schülerinnen bzw. Schüler ausgesondert oder nicht aufgenommen werden. Für die Pädagoginnen und Pädagogen ist es letztlich auch denkbar, ihre Stelle aufzugeben und sich so aus der Gemeinschaft zu lösen.
Darüber hinaus beeinträchtigen strukturelle Herausforderungen die Beziehungsgestaltung: In Einrichtungen der Elementarpädagogik arbeiten viele unterschiedliche Fachkräfte, teilweise eingeteilt in Früh- und Spätdienste und teilweise auch nur als Teilzeitkräfte. Dies bedeutet für die Kinder immer wieder Wechsel der zur Verfügung stehenden Personen. Darüber hinaus sind in der Deutschschweiz die Kindergruppen in Kitas wenig beständig, da viele Kinder nur einen Teil der Woche in der Einrichtung verbringen und die Plätze daher mehrfach belegt werden (vgl. Machmutow et al. 2013). Im Kindergarten und den ersten Schuljahren sind die Kindergruppen stabil, aber es arbeiten sehr häufig mehrere Fachpersonen in einer Gruppe, teilen sich das Pensum oder haben verschiedene Aufgabenbereiche, sodass den Kindern der Aufbau von festen sozialen Beziehungen zusätzlich erschwert wird.
6BEZIEHUNG ALS GRUNDLAGE FÜR EINE GUTE POTENZIALENTFALTUNG
In einer eigenen Studie (Pfiffner & Walter-Laager 2009) untersuchten wir 95 Kindergartenkinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren sowie ihre Pädagoginnen. Fokussiert wurden dabei die sozialen Beziehungen und ihre Auswirkungen auf die Motivation, das Fähigkeitsselbstkonzept und die Leistung.
In den Interviews zeigten sich viele facettenreiche Aspekte in den Bereichen »Vertrauen«, »Unterstützung durch die Lehrperson« und »Zugänglichkeit der Lehrperson«. 66 der 95 getesteten Kinder (= 69,5 %) schätzten die Beziehung zu ihrer Pädagogin in allen Belangen als gut bis sehr gut ein. Sie sind sich beispielsweise sicher, dass sie von ihrer Pädagogin gemocht werden und dass diese für sie sorge. Zudem vertrauen diese Kinder ihren Pädagoginnen voll und ganz. Nur vereinzelt berichten Kinder, dass sie Angst vor ihrer Pädagogin hätten oder dass diese lange wütend auf sie sei. Außerdem stimmen praktisch ausnahmslos alle Kinder der Aussage zu, dass es schön sei, wenn ihre Pädagogin mit ihnen zusammen sei. In der Tendenz können die Kinder einschätzen, was ihre Pädagogin verärgert, und die meisten Kindergartenkinder sind sich sehr sicher, dass sie von ihr nicht ausgelacht werden. Bei diesen beiden Fragen nützten die Kinder das gesamte Antwortspektrum aus; die Antworten haben also deutlich gestreut.
Bei den Kindern zeigt sich die Ausgestaltung der sozialen Beziehung zu den Pädagoginnen nicht in Form eines Rückgangs in der Motivation. Auch wenn sich Kinder weniger unterstützt oder gemocht fühlen, bringen sie sich im Alltag ein, dies auch mit dem Ziel, dass die Pädagogin sie positiv wahrnimmt. Die Kinder wünschen sich aber, als Menschen akzeptiert zu werden, und brauchen sicherheitsgebende Strukturen. Sie machen dies immer wieder an Unterstützungsleistungen fest. Stellvertretend folgen die Aussagen von sechs Jungen einer Fokusgruppe, die deutlich äußerten, dass ihnen ihre Pädagogin wenig helfe.
|
| Interviewerin: »Hilft Euch Frau Meier[4], wenn ihr sie braucht?« |
| Junge 2: »Sie hilft den Mädchen. Uns sagt sie immer ›Tschüss‹.« |
| Interviewerin: »Also, könnt ihr es schon? Was heißt denn ›Tschüss‹?« |
| Junge 2: »Wenn ich etwas frage oder so, sagt sie einfach ›Tschüss‹, sodass ich selber überlegen muss.« |
| Junge 4: »Ja. Und bei mir ist es genau gleich. Bei den Mädchen sagt sie es nie«. |
| Interviewerin: »Sicher? Hilft Frau Meier dort mehr?« |
| Junge 2: »Ja!« |
| Interviewer: »Was denkst du, weshalb ist das so?« |
| Junge 4: »Weil sie keine Jungs sind.« |
| Junge 2: »Weil die Mädchen nicht drauskommen. […].« |
| Junge 4: »Und wir gehen dann und fragen nochmals nach.« |
| Interviewer: »Und dann? Hilft sie euch beim zweiten Mal?« |
| Junge 3: »Nein. Dann sagt sie auch wieder ›Tschüss‹.« |
| Junge 4: »Nein, manchmal hilft sie.« |
| Junge 3: »Ja, aber nur manchmal, sonst sagt sie immer ›Tschüss‹. |
| Dann bin ich auch ›Tschüss‹.« |
| (Fokusinterview Jungen 300/301; Position: 116–142) |
|
Möglicherweise versucht die Pädagogin, diese Jungen selbst den Weg des Entdeckens gehen zu lassen. Die Jungen können das Verhalten ihrer Pädagogin aber nicht einordnen und fühlen sich von ihr nicht gut begleitet.
Generalisierend lässt sich festhalten, dass die Kinder es schätzen, wenn sie
•etwas über ihre Pädagogin wissen. Dies kann beispielsweise sein, ob sie ein Haustier hat oder wohin sie in die Ferien verreist.
•sich von ihr unterstützt fühlen und Hilfe erhalten. Unterstützung und Hilfe erfahren die Kinder in mannigfaltiger Art und Weise. So zum Beispiel, wenn die Pädagogin ihnen beim Lösen von schwierigen Problemen Anregungen gibt, wenn sie beim Spielen ab und an vorbeischaut und sich auf das Spiel einlässt oder wenn sie bei Streit die Kinder nicht allein lässt.
•gerecht ist. Kinder nehmen es wahr, wenn die Pädagogin parteiisch ist, wenn sie beispielsweise jemanden bevorteilt, und fühlen sich dadurch zurückgestoßen.
•ihr Verhalten klar einschätzen können. Demgegenüber mögen es Kinder nicht, wenn sie von der Pädagogin getadelt werden und sie für sie nicht gut »lesbar« ist. Ein Teil der Kinder vertraut deshalb ihrer Pädagogin nicht.
Читать дальше