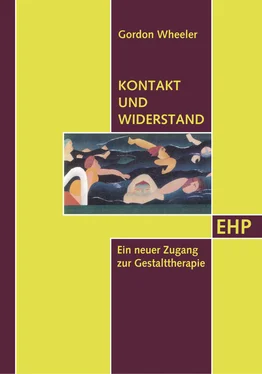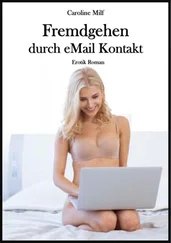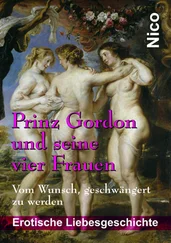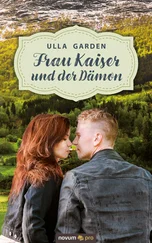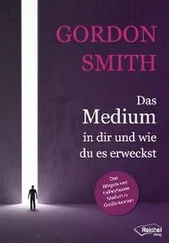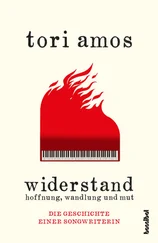In aller Fairness muss gesagt werden, dass das ursprüngliche Modell selbst, trotz einiger überzogener Forderungen neuerer Behavioristen, wahrscheinlich niemals solche Ansprüche erhob. Die Assoziationstheorie war, ursprünglich zumindest, vor allem der Versuch, mit einigem tautologischen oder »mentalistischen« Ballast aufzuräumen, den die Psychologie von der Philosophie her mitgeschleppt hatte, deren Zweig sie bis noch vor einem Jahrhundert immer war (vor allem mit ihren aristotelischen Konstrukten, die Bewegungen der Motilität zuschrieben, Zweck der Zweckhaftigkeit, Willen der Intentionalität usw.). In ihrem Versuch, von der endlosen Erzeugung von Zirkelschlüssen wegzukommen, waren sich die Assoziationstheoretiker (wie die vorigen Zitate zeigen) selbst einiger der Begrenzungen ihrer eigenen Theorie sehr wohl bewusst (s.a. Mandler & Mandler 1964) und brachten ständig eigene Konstrukte zweiter und dritter Ordnung hervor wie z.B. Lernen, Erfahrung, Interpretation, selektive Aufmerksamkeit und Emotionalität, um die offensichtlichen Transformationen von Sinnesdaten nach ihrem »Eintritt« in das Nervensystem zu erklären (Koffka 1935). Wenn sich das Modell dennoch so lange halten konnte (vgl. Petermann 1933, der wahrscheinlich den letzten Versuch unternahm, es systematisch zu verteidigen), dann geschah dies wahrscheinlich aus vorwiegend zwei Gründen. Der erste liegt in der schlichten Tatsache, dass Empfindung, Wahrnehmung und Denken offensichtlich auf irgendeine Weise mit der Welt »realer« externer Reize verbunden sein müssen, weil sonst schwer einzusehen ist, wie der Organismus jemals erfolgreich mit der Umgebung, wenn auch auf unvollkommene Weise, interagieren können sollte. Und der zweite Grund besteht in den wissenschaftlich-philosophischen Verbindungen zwischen dem Assoziationsmodell und der Newtonschen Physik, die solch eine einfache und befriedigende Reduktion der komplexen Erscheinungswelt auf einige wenige grundlegende Kräfte und Partikel ganz nach dem Paradigma der Assoziationstheorie anbot. Wenn man nach dem Newtonschen Modell zumindest theoretisch jemals damit fertig würde, die genaue Position und Geschwindigkeit auch des letzten einzelnen Partikels des Elementarstoffs im Universum zu katalogisieren – dann wüsste man folglich wenigstens potentiell nicht nur alles, was irgendwo zu einer bestimmten Zeit im Universum geschieht, sondern auch alles, was jemals geschah und geschehen wird. Praktisch gesprochen würde man natürlich niemals alle Koordinaten auflisten können. Jedenfalls gäbe es aber kein theoretisches Hindernis gegenüber totalem Wissen, nur eines der Zeit und der Ressourcen. Kurz gesagt, die Geheimnisse des Universums wären aufgeschlüsselt, und der Mensch würde sich hinsichtlich der physischen Welt schnell auf eine Position der Allwissenheit zubewegen. Wenn die geistige Welt dann auch noch erobert werden könnte, wäre diese Position wahrlich gottähnlich.
Die verführerische Kraft dieses Eroberungs- und Steuerungsmodells ist offensichtlich; selbst heute noch können wir es als einen berauschenden, wenn auch verlorenen Traum nachempfinden. Verloren, weil die Physik selbst, die die frühen Psychologen (und auch einige nicht so frühe) als ihren Prüfstein und ihren Führer nahmen, bereits damals ironischerweise fast hinweggeschwemmt wurde, und zwar zunächst durch die allgemeine Relativitätstheorie nach der Jahrhundertwende und dann in noch niederschmetternderer Weise in den zwanziger Jahren durch Heisenbergs Unschärferelation, die beide für sich den Nachweis beanspruchten, dass solch ein absolutes Wissen seiner eigenen Natur zufolge unerreichbar sei.
Trotzdem und ungeachtet der Ungereimtheiten des Assoziationsmodells, auf das die Gestalt-Schule so heftig reagieren sollte, war es dennoch dieses Paradigma, das für die ungeheure Produktivität der behavioristischen Schule in all ihren vielfältigen Verzweigungen einschließlich der Anwendungen auf Psychotherapie in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts unmittelbar verantwortlich war. Ein starker Irrtum (wie Aquin sagte und wie Paul Goodman ihn in seinen Arbeiten, die ich in den folgenden Kapiteln erörtern werde, gern zitierte) ist immer besser als eine schwache Wahrheit; und nirgends ist dies offensichtlicher als in der wissenschaftlichen Forschung. Die Gestalt-Schule beanspruchte dagegen jene dritte Möglichkeit, nämlich eine starke Wahrheit erfasst zu haben, deren Konsequenzen ich im folgenden erörtern werde.
Die Gestalt-Schule – frühe Arbeiten
Wertheimers ursprünglicher Aufsatz von 1912 wich rückblickend betrachtet trotz alledem nicht allzu sehr von den Prinzipien der Assoziationstheorie ab. Zwar identifizierte er einen spezifischen »einheitlichen Prozess« – das Phi-Phänomen –, durch den die einzelnen Reize innerhalb des Subjekts in ein kontinuierliches Bild übersetzt wurden; und in dieser Hinsicht kann man sagen, dass er sich von der reinen »reizgebundenen« Position wegbewegt hatte. Aber diese »einheitlichen Prozesse« wurden selbst »in besonderer Weise auf der Grundlage einer einzigen Erregung konstruiert« (Wertheimer 1912). Dies ist mit anderen Worten wieder Exners zentrale Konfluenz, eine Art Verschmelzung (oder ein »Kurzschließen«, wie Wertheimer es ausdrückte) von einzelnen Erregungen des Rezeptors. Das heißt, die Betonung und die Steuerung in der Wahrnehmung wird immer noch den externen Reizen und ihren entsprechenden Eins-zu-Eins-Erregungen zugesprochen, die dann auf einem bestimmten Energieniveau »einen Sprung machen« und sich sozusagen in dem Kreislauf des Empfänger-Subjekts selbst vermischen. Dies ist wiederum wie bei vielen der einfacheren Modelle der Assoziationstheorie eine Sichtweise, die in vieler Hinsicht dem Alltagsverständnis entspricht: Das, was ich sehe, ist offensichtlich auf bestimmte und recht abhängige Weise mit dem verknüpft, was »da draußen« gesehen werden kann. Wie sonst könnte meine Welt so praktisch funktionieren, wie sie es tut? Beispielsweise steuere ich hauptsächlich mit meinen Augen; ich falle selten hin und fahre auch nicht gegen einen Baum. Mein Nervensystem »nimmt« daher das »auf« und verarbeitet es, was mehr oder weniger »dort« ist – wie die Assoziationstheoretiker behaupten. Die Frage ist nicht, ob dies geschieht, sondern wie es geschieht. In dieser Hinsicht hatte Wertheimer 1912 noch keinen sehr großen Schritt über die anerkannte Erklärung der Assoziationstheoretiker hinaus getan.
Aber es gab da einen kleinen Unterschied, und um diesen kleinen Unterschied hinsichtlich einer etwas komplexeren Rolle des Subjekts herum – wenigstens was die Erklärung der Wahrnehmungsprozesse gegenüber dem vorherrschenden Modell betraf – entwickelten sich rasch eine neue Denkrichtung und ein neuer Arbeitszusammenhang. Die jungen Psychologen Wolfgang Köhler und Kurt Koffka vereinten ihre Kräfte mit denen Wertheimers zunächst in Frankfurt und später in Berlin und begannen bald zusammen mit ihren Studenten und Schülern, eine Reihe von Schriften herauszubringen sowie Experimente und Argumente zu entwickeln, die alle das Ziel hatten, die viel größere Aktivität des »passiven« wahrnehmenden Subjekts hervorzuheben, als dies zuvor angenommen wurde, und die Unterordnung all dieser Aktivitäten unter bestimmte allgemeine Prinzipien der Organisation zu skizzieren. Sie gingen über die ursprüngliche Behandlung der Wahrnehmung kontinuierlicher Bewegung und des Phi-Phänomens hinaus und verlagerten ihren Fokus auf die allgemeinere Frage der Konfiguration selbst: Das heißt, wie kommt es, dass wir überhaupt »Dinge« in eigenständiger und abgrenzbarer Weise sehen, wie wir es normalerweise tun, aus der visuellen Kakophonie von Lichtreizen, die auf uns im Augenblick des Öffnens unserer Augen eindringen? Wie kommen wir, besonders in ungewöhnlichen (und daher, nahm man an, veranschaulichenden) Fällen wie zum Beispiel optischen Illusionen, Einschätzen der Größe und des Abstands oder begrenzter Sichtbarkeit und Skizzenhaftigkeit zu Gesamteindrücken von Dingen aus diesem Beschuss »ursprünglicher« Reize? In einer außerordentlich fruchtbaren, paradigmatischen Veränderung war die Antwort Wertheimers, dass eben dies nicht geschieht. Es sind gar nicht, so argumentierte er, die »ursprünglichen« Reize, die von den Wahrnehmungsorganen »aufgenommen« werden, sondern vielmehr die ganzen Konfigurationen. Im Hinblick auf den wahrnehmenden Organismus heißt das, dass das »sinnvolle Ganze« der Reiz ist (Wertheimer 1959). Von daher kommt das berühmte Gestalt-Diktum (Koffka 1935), dass das Ganze den Teilen vorausgeht. Diese ganzen Konfigurationen oder »Figuren« (um Ehrenfels’ Terminologie zu benutzen, die von der Gestalt-Schule übernommen wurde) können dann in untergeordnete Teile aufgegliedert oder analysiert werden; aber diese Teile haben selbst die gleichen Merkmale der Figur vor einem Grund – das heißt der ganzen Konfiguration: Wäre dem nicht so, könnten wir sie nicht »sehen«; das ist es, was »sehen« bedeutet. Wenn die ganze Konfiguration bruchstückhaft oder unterbrochen oder sonst irgendwie unvollständig ist, neigt das Subjekt dazu, dennoch das Ganze zu sehen (Köhler 1922; Wertheimer 1925) oder etwas zu unternehmen, um die fehlenden Teile zu ergänzen, oder es erfährt eine messbare Spannung und subjektive Frustration. Auf diese Weise sind wir »verdrahtet« (um eine spätere kybernetische Metapher zu verwenden); unter normalen Umständen rufen isolierte »ursprüngliche« Reize bei den Subjekten organisierte Reaktionen hervor, die über dem Niveau des »reinen Reflexes« oder Zuckens liegen (Goldstein 1940); »höhere«, besser organisierte Reaktionen können auch nicht aus den elementaren Zuckungen, die nach dem berühmten Bild des Assoziationsmodells aufgefädelt wären wie »Perlen auf einem Faden«, »aufgebaut« werden (Koffka 1935). Organisation, organisierte Figur, ist der ursprüngliche »Baustein« der Wahrnehmung und der Reaktion des Subjekts auf den Wahrnehmungsreiz. Daher sollte sich die Aufmerksamkeit der Forschung auf diese organisierte Figur – ihre Analyse, ihre Merkmale, ihre Gestalt, Struktur und Auflösung – richten.
Читать дальше