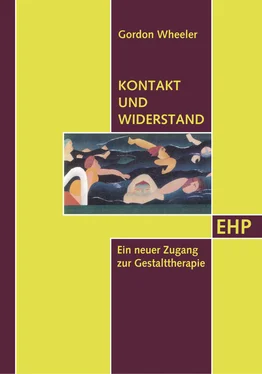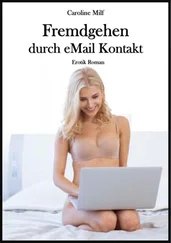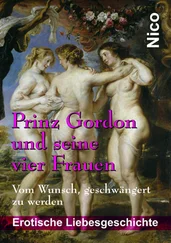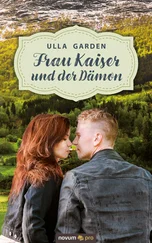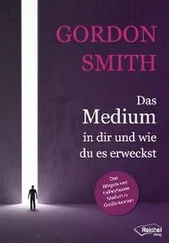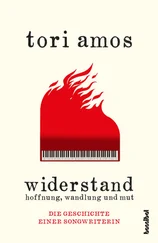An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass es in dieser frühen Phase der Gestalttheorie noch etwas unklar bleibt, ob die »organisierten Ganzheiten«, über die wir sprechen, »in« der Natur oder »in« dem Wahrnehmungsorganismus, also in der Struktur des Nervensystems selbst (oder vielleicht, wie wir heute eher sagen würden, in der Wechselbeziehung dieser beiden) gefunden werden. Mit anderen Worten – um die Richtung der nachfolgenden Gestaltforschung vorwegzunehmen (z.B. Lewin 1926) –, ist es das eigene Interesse des Subjekts oder irgend ein anderer subjektiver Drang, der bestimmte Formen, bestimmte Figur-Grund-Zergliederungen aus einem Feld organisiert, das für sich genommen fast unendlich formbar ist? Oder sind die Wahrnehmungsstrukturen, die Gestalten (im Original deutsch; Anm. d. Übers.), über die wir hier sprechen, bereits in der Umgebung vorgegeben?
Hinsichtlich dieser Frage blieb Wertheimer selbst für den Rest seines Lebens mehr oder weniger unschlüssig (Wertheimer 1961; Köhler 1959). In dieser frühen Phase seiner eigenen Forschung neigte Wertheimer mit seinen Kollegen sicherlich dazu, den Akzent bei dieser Interaktion auf die Seite der Umwelt zu legen. Ein großer Teil der Forschungsenergie wurde daher in die Bemühung investiert, die verschiedenen Merkmale und Eigenschaften der Gestalt oder des Figur-Grund-Prozesses abzugrenzen. In diesem Prozess brachte vor allem Wertheimer eine scheinbar endlose Reihe von »Gesetzen« über das »Verhalten« der Wahrnehmungsgestalten hervor. Die Gesetze der Nähe, der Gleichheit, der Geschlossenheit sowie die Prinzipien der Klarheit, Bestimmtheit, Einheit, Begrenztheit und Trennung, ja sogar abstrakte Kategorisierung selbst (was jedoch kein Erklärungsprinzip nach der Sichtweise der alten »mentalistischen« Konstrukte, wie ich sie oben erörterte, zu sein scheint) – all diese wurden zu unterschiedlichen Zeiten postuliert, und es wurden Versuche unternommen, sie in dem Bemühen zu messen (Köhler 1920, Koffka 1930), zu quantifizierbaren und voraussagbaren Regeln zu gelangen, wann eine gegebene Serie »ursprünglicher« Reize in der Umgebung zu einer Wahrnehmungsgestalt »zusammenfließt« und wann nicht. All diese Prinzipien in Wertheimers Modell (Köhler 1920, Petermann 1932) wurden dem Gesetz der Prägnanz untergeordnet, welches schlicht beinhaltete, dass die Wahrnehmung zu einer organisierten Form hin tendiert und dass die Organisation so »gut (d.h. einfach, kohärent) [ist], wie es unter den gegebenen vorherrschenden Umweltbedingungen möglich« ist (Koffka 1935, 110). Mit anderen Worten: die Ökonomie der Organisation, die bestmögliche Bedeutung oder Information in der einfachsten strukturellen Form. Die Übersetzung solcher Abstraktionen in objektive, quantifizierbare Maßeinheiten würde selbstverständlich eine schwierige, wenn nicht unlösbare Aufgabe darstellen.
Im Rückblick muss man sagen, dass diese ganze Forschungsrichtung, die uns heute als auf seltsame Weise von einem assoziationistischen oder sogar »mentalistischen« Geist durchzogen erscheinen mag, im großen und ganzen eine Sackgasse war. Trotz des farbigen Spektrums interessanter und sogar überraschender Wahrnehmungsprobleme, die heute normalerweise mit dem Namen Gestalt verbunden werden, gelang es Wertheimer und seinen Kollegen niemals, jenes Ziel quantifizierbarer Ergebnisse zu erreichen, von dem sie hofften, dass es ihre Psychologie auf das Niveau der »harten« Wissenschaften heben würde (Köhler 1947; Petermann 1932). Der Grund für diesen Fehlschlag lag in der tautologischen Natur der verschiedenen »Gesetze« und Aussagen selbst. Nehmen wir beispielsweise das übergreifende Gesetz der Prägnanz, von dem sich die anderen Gesetze ableiten lassen sollten. Indem die Gestalt-Schule behauptete, dass Wahrnehmungen organisierte Konfigurationen sind, nahm sie eine Verallgemeinerung von Daten vor, die zu einem großen Teil zumindest qualitativ verifizierbar waren. Indem sie von dieser Aussage auf das »Gesetz« schlossen, dass diese Konfigurationen »so gut wären, wie es die Umweltbedingungen erlaubten«, wurde implizit das Versprechen der Messbarkeit hinzugefügt. Aber was ist »gut«, und welches sind diese »vorherrschenden Bedingungen«? In der Praxis erwies es sich als unmöglich, diese Konzepte experimentell zu überprüfen, (außer was die Ergebnisse selbst betraf, d.h. die besondere Auflösung in Figur und Grund, die tatsächlich erreicht wurde). D.h., die abhängige Variable (»gute Gestalt«), die sich dem »Gesetz« zufolge mit der unabhängigen Variable (»vorherrschende Bedingungen«) verändern sollte, konnte nur in den Begriffen jener Bedingungen definiert werden und vice versa. Von der Absicht her sollte sich »gut« auf einen Zustand minimaler Energie beziehen (Köhler 1920; 1922) – in Analogie natürlich zu jenen bevorzugten Zuständen physikalischer Systeme, auf die die frühen Gestalttheoretiker ihr eigenes Modell zu gründen hofften. Diese »minimale Energie« konnte jedoch als Ergebnis nur vermutet, nicht gemessen werden – ganz ähnlich wie die »vorherrschenden Bedingungen« auch. Von diesen nahm man an, sie seien von der Art, dass sie genau jene bestimmten Figur-Grund-Auflösungen hervorbrachten, die tatsächlich von dem Subjekt erzeugt wurden, und nicht von anderen Faktoren.
Rückblickend können wir uns auch fragen, warum Wertheimer dazu neigte, die eine »vorherrschende Bedingung« aus seinen Überlegungen auszuklammern – das eigene Interesse, die Motivation oder das Bedürfnis des Subjekts –, die am ehesten messbar gewesen wäre, und warum er keinen definitorischen Weg aus den tautologischen Problemen, die mit dem Wort gut gegeben waren, anbot. (Das heißt, wenn »gut« wenigstens mit irgendeinem Ergebnis oder einer Bedürfnisbefriedigung des Subjekts in Beziehung hätte gesetzt werden können, dann wäre es unabhängig von den anderen experimentellen Variablen definierbar gewesen und hätte der Validierung der »Gesetze« besser dienen können.) Die naheliegende Antwort wäre, dass solch eine Berücksichtigung des innneren Zustandes des Subjektes der frühen Gestalt-Schule als »vitalistisch« erschienen wäre (Wertheimer 1925) – das heißt, man hätte vage und subjektive »innere Zustände« als erklärende Konstrukte im alten Sinne des Assoziationsmodells eingeführt. Tatsächlich zählten Interesse und selektive Aufmerksamkeit zu denjenigen Prinzipien, die die Assoziationstheoretiker anführten (Köhler 1925; Müller 1923), um die Organisation der ursprünglichen Empfindungen innerhalb des wahrnehmenden Subjekts zu erklären. Außerdem kommen, wie Goldstein später zeigen sollte (1939), Fragen des Interesses und der Bedürfnisse nicht so leicht oder nicht notwendigerweise unter Laborbedingungen für visuelle Wahrnehmung zum Tragen, bei denen Menschen (oder gelegentlich auch Tiere) einfach aufgefordert werden, über das zu berichten oder darauf zu reagieren, was sie sehen, im allgemeinen anhand von täuschenden oder mehrdeutigen Reizen, die keine besondere persönliche Bedeutung für die Versuchspersonen selbst haben.
Dass der Akt oder der Prozess der Wahrnehmung sowie der Prozess der Auflösung der Wahrnehmung selbst von eigenständigem Interesse oder von einer Notwendigkeit für das Subjekt seien, stellte eine der entscheidenden Entdeckungen der Gestalt-Schule dar. Aber gerade deshalb fürchteten sich die Gestalt-Forscher der ersten Generation zweifellos davor, dass der reine zu untersuchende Prozess verzerrt oder verwischt worden wäre, statt geklärt zu werden, wenn man zu viele andere »Lebensnotwendigkeiten« zugelassen hätte, die über den faszinierenden und unvermeidbaren Tanz der Figur-Grund-Auflösung selbst hinausgegangen wären. Dies war schließlich ihr eigener, spezieller theoretischer Beitrag. Mit anderen Worten, wir haben hier wieder einen Fall, bei dem die Annahmen des Modells die Wahl des experimentellen Materials und die Bedingungen bestimmen – wobei die Ergebnisse dann dazu neigen, die ursprünglichen, teilweise ungeprüften Annahmen in ihren eigenen Begriffen zu bestätigen. Es erwies sich jedoch (im Gegensatz zu den reinen Behavioristen) niemals als möglich, eine besonders interessante oder nützliche Theorie der Persönlichkeit, der umfassenderen menschlichen Funktionsweisen, zu konstruieren, ohne auf die Berücksichtigung der Bedürfnisse oder Intentionen des betroffenen Subjekts selbst zurückzugreifen. Es ist daher nicht überraschend, dass genau in diesem vernachlässigten Bereich – selektive Aufmerksamkeit, Interesse und Bedürfnis – die nachfolgenden und äußerst fruchtbaren Erweiterungen des sich entwickelnden Gestaltmodells vorgenommen wurden; Erweiterungen, die Wertheimer selbst niemals ganz begriff, die aber für unsere weitere Diskussion der Erweiterung des Wahrnehmungsmodells der Gestalt für die Bereiche der Persönlichkeitstheorie und der Psychotherapie von entscheidender Bedeutung sein werden.
Читать дальше