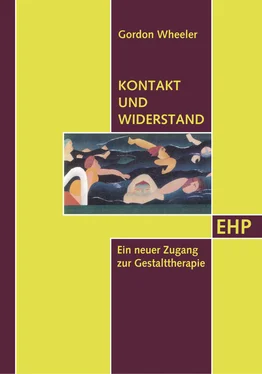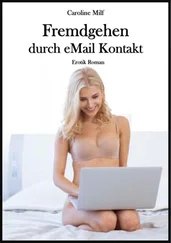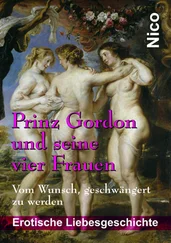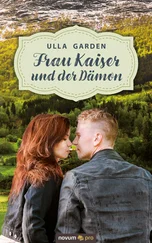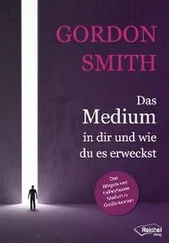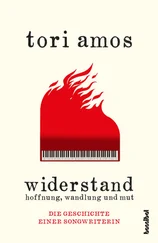In Wirklichkeit verlief die Entwicklung natürlich viel allmählicher, mit einigem Auf und Ab, wie es bei theoretischen Durchbrüchen immer der Fall ist – sie war viel atomistischer oder »assoziativer« im Gegensatz zu diesem sehr gestaltmäßigen Mythos eines einzigen Augenblicks Newtonscher Einsicht. Das Problem atomisierter versus kontinuierlicher Wahrnehmung geht mindestens bis zu Zeno im fünften Jahrhundert vor Christus zurück, mit dessen berühmtem Paradox von der Schildkröte und dem Hasen (da sich die Schildkröte immer weiter vorwärts bewegt, wie langsam auch immer, während der Zeit, die der Hase braucht, um dahin zu gelangen, wo die Schildkröte vorher war, kann er die Schildkröte rein logisch gesehen scheinbar nie überholen). Die Schwierigkeit besteht hier in der scheinbaren Unvereinbarkeit von fragmentierten und kontinuierlichen Prozessen, ganz gleich wie klein die Fragmente sind, in die man das betreffende Wahrnehmungsphänomen zergliedert (wie das Assoziationsmodell es vorhatte). In der Mathematik wurde dieses Problem theoretisch erst nach ein paar tausend Jahren durch die Erfindung der Differentialrechnung durch Newton und Leibniz gelöst – also durch die Mathematik kontinuierlicher Funktionen. In der Psychologie geht die Verwendung des Begriffs »Gestalt« selbst – für diese und andere Probleme des assoziativen Ansatzes – auf v. Ehrenfels im Jahr 1890 zurück (es war auch v. Ehrenfels, der die Begriffe »Figur« und »Grund« in die Wahrnehmungspsychologie einführte, s. Koffka 1935). Mach selbst, der gewöhnlich als Begründer der modernen Psychologie angesehen wird, war nicht nur mit den »reinen assoziativen« oder Reiz-Reaktions-Mustern in seiner Forschung beschäftigt, sondern auch mit der umfassenderen Frage, wie es kommt, dass die Dinge uns so erscheinen, wie sie es tun (Petermann 1932, 3). In ähnlicher Weise widmeten sich Schumann (1900), Müller (1923), Krüger (1913, 1915) und besonders Martius (1912) alle der Qualität der »Ganzheit« in der Wahrnehmung und kritisierten auf verschiedene Weise die »atomistische« Theorie, die besagt, dass Wahrnehmung nur die Summe einer Reihe einzelner Stimuli sei, von denen jeder vermutlich eine bestimmte Gehirnzelle oder mehrere Zellen aktivieren würde – und verwendeten solche vereinheitlichenden Begriffe wie »Produktion«, »Kohärenz-Theorie«, »Komplexqualität« und sogar »Gestaltqualität«. Exner schrieb 1894 (im gleichen Jahr also, in dem Freud zum ersten Mal die »Abwehrmechanismen«, eine weitere »ganze Konfiguration« der Funktionsweise erwähnte, mit der ich mich eingehend in den nächsten Kapiteln befassen werde) folgendes: »Der ganze Eindruck, der durch ein Bild erzeugt wird, das über die Retina blitzt, wird durch die Erregung unzähliger und funktional unterschiedlicher Fasern ausgelöst. Dass wir trotzdem einen einheitlichen Eindruck gewinnen, in welchem die getrennten Sinneswahrnehmungen unbemerkt bleiben, ist in dem begründet, was ich das Prinzip zentraler Konfluenz nennen würde« (Exner 1894, 201). Exners »zentrale Konfluenz« kommt dem Phi-Phänomen von Wertheimer zwanzig Jahre später sicherlich sehr nahe.
Nach den Vorstellungen der »Wundt-Schule« oder der reinen Assoziationstheorie, die zur Jahrhundertwende vorherrschte, sollte Wahrnehmung folgendermaßen vor sich gehen: Ein bestimmter, unterscheidbarer Reiz in der Umgebung – sagen wir eine bestimmte Frequenz und Intensität von Licht, die von einem bestimmten Objekt ausgesandt wird und mit physikalischen Geräten messbar ist – trifft in einem bestimmten Winkel und mit einer bestimmten Energie auf die Retina. Dies löst Schritt für Schritt eine weitere neurologische Sequenz aus, die wiederum zu der Stimulierung einer bestimmten Gehirnzelle oder einem Muster von Zellen führt, welche dann entweder das geistige Bild »produzieren« oder irgendwie selbst dieses Bild »sind« (das Modell ist an dieser entscheidenden Stelle ein wenig unklar; siehe die Diskussion bei Koffka 1935; auch Köhler 1947). Die Theorie ist also in zweierlei Hinsicht »reduktionistisch«: Das heißt, das geistige Ereignis kann ganz exakt auf physische Ereignisse »außerhalb« reduziert werden und vice versa. Theoretisch zumindest sollte es also eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen äußerem Objekt und innerem Bild geben (oder zumindest zwischen innerem Bild und dem, was die Assoziationspsychologen den »unmittelbaren Reiz« nannten, in diesem Fall also das tatsächliche Maß und die Qualität des Lichtes, das auf die Oberfläche der Retina traf – da das »Ding an sich« als Reiz unter den unterschiedlichen Bedingungen des Lichts, der Distanz, der Luftqualität, der Bewegung usw. variieren kann).
Auf die Frage, wie eine endliche Zahl von Zellen der Netzhaut solch ein erstaunlich großes Spektrum von geistigen Bildern hervorbringen kann, ist die Antwort der Assoziationstheoretiker: durch eine Neukombination und Permutation unabhängiger Elemente, d.h. Zellen. Ein Bild zur Veranschaulichung könnte etwa das Telefonnetz einer großen Stadt sein, bei dem die Neukombination von lediglich zehn einfachen Reizelementen in einheitlich variierenden kleinen Ketten von jeweils sieben Elementen verantwortlich ist für alle Telefonverbindungen, sagen wir, von New York City mit ihren vielen Millionen verschiedener Möglichkeiten, ganz abgesehen von den möglichen funktionalen Erweiterungen, Konferenzschaltungen, Ruf-Weiterschaltungen, Wartepositionen, ja sogar Vermittlungshilfen und anderen Möglichkeiten, um die Ketten selbst neu miteinander zu verbinden. Wenn man drei weitere Elemente hinzunimmt, kann man ganz Nord-Amerika erfassen; noch einmal etwa fünf weitere Elemente, und man hat die ganze Welt versorgt. Auf diese Weise ist es möglich, wie die Assoziationstheoretiker behaupten, Konstrukte und komplexe Erinnerungen, sogar abstrakte Ideen und Problemlösungsmuster aus einer begrenzten Zahl einfacher einheitlicher und voneinander unterscheidbarer »Bausteine« durch komplexe Neukombinationen aufzubauen, ohne vage und tautologische »Geister in der Maschine« einführen zu müssen, die erklären, wie die Elemente sich organisieren.
Bei solchen Annahmen ist es natürlich, dass sich viele Laborforschungen nach diesem Paradigma auf die Phrenologie konzentrierten: Das heißt, wo genau im Gehirn könnten die Pfade und speziellen Zellen gefunden werden, in denen die einzelnen Sinneseindrücke »aufbewahrt« wurden, und wie wurden diese Zellen nach dem Reiz-Reaktions-Muster mit anderen kombiniert (vgl. die Diskussion dieser Art von Metaphorik als Forschungsorientierung in der Assoziationstheorie bei Goldstein 1939, 1940; auch bei Koffka 1935, bes. Kap. III). Viel von dieser Arbeit wurde, wie Goldstein hervorhob (1939) dann auch gar nicht in vivo durchgeführt, sondern beschäftigte sich mit Reaktionsmustern des Nervengewebes in vitro oder mit den Nervenreaktionen hirntoter Tiere, deren Gehirne entrindet worden waren und die tatsächlich die Art reiner »reizgebundener« Reaktionsmuster des assoziativen Modells demonstrierten, ganz ähnlich, wie sie Goldstein später bei bestimmten hirngeschädigten Kriegsveteranen im vorderen Hirnlappen finden sollte. Auf diese Weise tendierte das Arbeitsparadigma, wie immer in der Wissenschaft, dazu, den Forschungsansatz zu steuern – ein Phänomen, das übrigens durch die Gestaltspsychologie am besten erklärt werden kann. Die zugrundeliegenden Annahmen des Modells, die oft nicht überprüft werden, bestimmen auf fragwürdige Weise die Bedingungen und Vorgehensweisen der Forschung und die Art von Fragen, die gestellt werden – und daher auch die Befunde, die dann das Modell bestätigen. Dass die Gestaltforschung selbst dieser Art von ungeprüften Annahmen gegenüber nicht immun war, wird in der folgenden Erörterung deutlich werden.
Das Problem jedoch mit dieser Art eines »Netzwerk«- oder »Schaltkreis«-Modells als Erklärungsmetapher in der Assoziationstheorie ist, dass man sich das Gehirn nicht so vorstellen darf, dass es nur das Telefonnetz enthält mit seinen vielen tausend Kilometern Kabel und den verschiedenen Schaltfunktionen, sondern dass man in gewisser Hinsicht auch alle Telefonkunden mitdenken muss; nicht nur die Schaltungen, sondern die Botschaften, die durch diese Drähte gehen, die Gespräche, Bilder, Prozesse, Interaktionen, all diese sind auch irgendwie »im« Gehirn, und zwar scheinbar in einer organisierten und steuerbaren Weise. An diesem Punkt bricht die Assoziationsmetapher zusammen, und man ist geneigt zu fragen, wie man von solch einer vereinfachten und offensichtlich naiven Auffassung des geistigen Lebens jemals erwarten konnte, dass sie brauchbare und vollständige Erklärungen hervorbringen könnte für komplexe abstrakte, geistige Funktionen, die weit abseits von irgendwelchen »unmittelbaren Reizen« auf einer qualitativ anderen Ebene stattzufinden scheinen.
Читать дальше