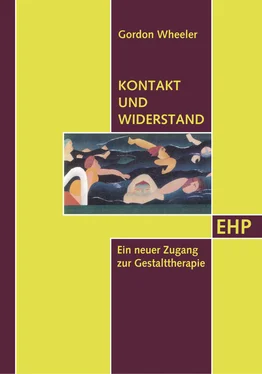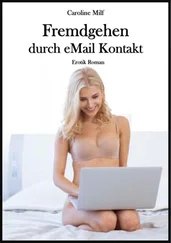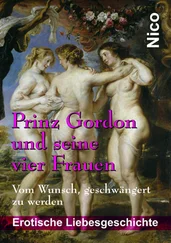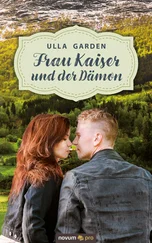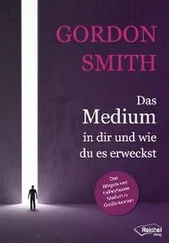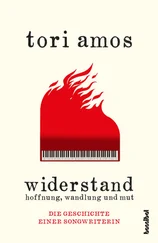Dagegen ist nichts einzuwenden, aber es sollte jetzt klar sein, dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche Landkarte handelt, wie sie einem naiven Reisenden von einem wohlmeinenden, aber wenig engagierten Führer – falls es so etwas geben sollte! – in die Hand gedrückt werden könnte, sondern vielmehr um ein höchst parteiisches Dokument, eine Einladung, den Kontaktprozess selbst in einer ganz bestimmten Weise (und nicht in einer anderen), auf einer Landkarte, gemäß bestimmten, vorher vereinbarten Merkmalen des Grundes abzubilden. Und wieder sind wir nach ein paar Abschnitten bei einem der grundlegenden Eckpfeiler der philosophischen Kritik von Goodman und Perls an der »etablierten« Psychotherapie jener Zeit angelangt, nämlich der radikalen, positiven Neubewertung des leidenschaftlichen Begehrens als dem entscheidenden Weg zur Wahrheit und zu angemessenem Handeln – in scharfem Kontrast sowohl zu den klassischen Freudschen Ansichten als auch in gewisser Hinsicht zu den östlichen mystischen Überzeugungen von der Erleuchtung durch Objektivität, Sublimation oder Entrückung. Lassen Sie mich in gleicher Weise (in Vorwegnahme vieler nachfolgender Argumente) den Widerstand des Lesers als das eigentliche Zeichen für leidenschaftliches oder aktives Engagement im Kontaktprozess selbst anerkennen und wertschätzen und nicht als ein Blockieren oder Sabotieren dieses Prozesses.
So weit, so gut; aber es besteht mindestens noch ein weiteres Risiko für diese Art einer parteilichen Einführung: Im Verlauf der Kartierung des Geländes, das vor uns liegt, und bei dem Versuch, die verschiedenen Stadien der Reise so darzustellen, als folgten sie nahtlos und notwendigerweise nacheinander, kann es geschehen, dass die gesamte Argumentation des Buches einen strengeren logischen Charakter, eine linearere Erscheinungsform erhält, als dies bei der ursprünglichen Entwicklung der Fall war, die eher organisch war, sprunghaft vor- und zurückging und sich von einer zentralen Idee her zu den einzelnen Komponenten hin verzweigte – mit einem Wort: eher »Gestalt« war. In einem solchen Prozess kann es vorkommen, dass die zentralste These eines Buches, die grundlegendste Idee, die die einzelnen Teile durchdringt und organisiert, nirgends klar formuliert wird (wie die Neueinschätzung des Begehrens, die dem zweiten Band von Gestalttherapie zugrunde liegt, nicht direkt in dem Buch erörtert wird). Ich möchte daher die organisierende Grundidee formulieren, bevor ich mit der Landkarte für die einzelnen Kapitel beginne: dass nämlich das Kontaktmodell, das uns von Goodman und Perls überliefert und durch viele nachfolgende Autoren ausgearbeitet wurde, im theoretischen Sinn figurgebunden ist; dass die Analyse dieses Kontaktprozesses (oder der Bewusstheit oder der Erfahrung) unvollständig ist ohne direkte Berücksichtigung der Organisationsprinzipien oder Strukturen des Grundes, die in einigen Fällen über die Situationen und über die Zeit hin wirksam sind, und die die Figuren im Kontakt selbst beeinflussen und beschränken; dass Psychotherapie (oder jeder andere Veränderungen auslösende Prozess) immer eine Angelegenheit der Neuorganisation der Strukturen des Grundes über die Zeit hin ist und nicht nur der Kontakt-Figuren im Augenblick; dass diese Überbetonung der Figur für das Gestaltmodell, zumindest in theoretischer Hinsicht, ein Handicap bei der Bearbeitung einer Fülle klinischer und systemischer Prozesse war; dass das Modell von Goodman und Perls einige Verzerrungen und innere Widersprüche enthält, die die Entfaltung des vollen Potentials dieses Modells behinderten; und schließlich, dass die Revision dieser widersprüchlichen Annahmen die Formulierung eines Modells ermöglicht, das bestimmte neue Chancen eröffnet – nämlich die Neueinschätzung von »Widerständen« und die Möglichkeit, »klinische« und »organisatorische« Probleme zum ersten Mal mit denselben theoretischen Begriffen anzupacken. All dies sind Variationen der gleichen Grundidee, nämlich der Hinwendung der ungeteilten Aufmerksamkeit in der Gestaltanalyse auf das Problem der Strukturen des Grundes. Dies ins Blickfeld der Aufmerksamkeit zu rücken, ist der Zweck dieses Buches.
Um den Weg für diese Diskussion zu bereiten und dabei auf besondere, bisher nicht beschrittene theoretische Wege hinzuweisen, werde ich zunächst im ersten Kapitel an den Anfang dieses Jahrhunderts zurückgehen, um einiges von der faszinierenden und revolutionären Arbeit der ersten Generation akademischer Gestaltpsychologen in den Blick zu nehmen (zu nennen sind hier insbesondere Wertheimer, Koffka, Köhler und deren Nachfolger); ihre Arbeit war von so bedeutendem Einfluss, dass es unmöglich ist, sich heute irgendeine Psychologie vorzustellen, nicht einmal eine eindeutig »behavioristische«, die nicht grundlegend gestaltorientiert wäre. Von dort werde ich mich den Auswirkungen dieser Arbeit auf das zuwenden, womit sich die zweite Generation der »Gestaltschule«, besonders Lewin und Goldstein, beschäftigte – und zwar nicht deshalb, weil deren weitreichende Differenzierungen des ursprünglichen Wahrnehmungsmodells im Bereich der Persönlichkeit und des Verhaltens das Modell von Goodman und Perls direkt beeinflusst hätten, sondern weil dies seltsamerweise gerade nicht geschah. Die Gründe hierfür werden im zweiten und dritten Kapitel näher behandelt. Dabei werde ich bewusst eine Position einnehmen, die im Gegensatz zu denen von Henle (1978), Arnheim (1949) und (manchmal) von Perls selbst (vgl. z.B. 1969b) steht. Sie alle behaupteten, dass zwischen der eigentlichen Gestaltpsychologie und dem Modell der Gestalttherapie keine wichtigen oder überhaupt keine Zusammenhänge bestünden. Im Gegensatz dazu werde ich im ersten Kapitel (und auch in den folgenden Kapiteln) zu zeigen versuchen, dass es unmittelbare und bedeutsame Zusammenhänge gibt, auch wenn sie nicht immer vollständig entwickelt wurden. Perls selbst spürte diese Verbindung zwar zunächst, formulierte sie jedoch in seinem frühen gemeinsamen Werk mit seiner Frau Laura Perls Ich, Hunger und Aggression (Perls 1947), nicht sehr klar aus.
Diesem frühen Werk der beiden Perls’ werde ich mich im zweiten Kapitel widmen. Aus der Perspektive des späteren Gestaltmodells ist dieses Buch bestenfalls »skizzenhaft« (um Perls’ eigenen Begriff zu verwenden): Die Gestaltideen, die er zu Beginn ankündigte, werden im größten Teil des Textes kaum entwickelt, und wenn sie schließlich kurz am Ende berührt werden, wird ihre Verbindung mit der Gestaltperspektive nicht deutlich gemacht. Eine Anmerkung ist hier auch auf die Gefahr hin angebracht, dass ich etwas betone, was unstrittig ist: nämlich dass es ohne Fritz Perls kein Gestalttherapie-Modell gäbe. Wie bereits oben erwähnt, war es Perls, der zuerst die Implikationen einer Gestaltsicht der Bewusstheit für einen neuen Zugang zur Persönlichkeit und zur Psychotherapie »roch« (diese Konsequenzen wurden, wie im ersten Kapitel ausgeführt wird, im frühen Werk von Lewin und Goldstein sehr deutlich, aber Perls kannte die Arbeit Lewins vielleicht nicht und verstand seinen eigenen Aussagen zufolge [1969b] Goldsteins Arbeit erst viele Jahre später). Fritz Perls war es auch, der zusammen mit seiner Frau die Forschungsgruppe zusammenbrachte, die das Gestalttherapie-Modell in New York in den Jahren unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg ausformulierte. Und zweifellos war es auch Perls, der Paul Goodman das Original einer Monographie gab, die zumindest der Ausgangspunkt war für Goodmans umfassendere theoretische Darstellung im Jahr 1951. Leser dieses zweiten Kapitels, die Perls persönlich kannten, merkten meist an, dass etwas Wesentliches dieses Mannes selbst – seine Präsenz, seine Hingabe an Lebendigkeit und Authentizität, seine eigene, besondere Art von Integrität oder Ganzheit – in dieser eher rein theoretischen Kritik nicht durchkomme. Nach den Worten von Ed Nevis stand Perls für eine »ganz neue Art, in der Welt zu sein«, die uns dazu veranlasst, auf das zu horchen und es wertzuschätzen, was wahrhaftig in uns ist, bevor wir uns einer vorzeitigen Resignation hinsichtlich dessen überlassen, was möglich oder praktisch oder sozial am ehesten akzeptabel ist. Vielleicht ist es unvermeidlich, dass für jene unter uns in den nachfolgenden Generationen, die nicht die Chance hatten, von Perls persönlich angeregt zu werden, im Laufe der Zeit etwas von der inspirativen Kraft aus dem Kontakt mit ihm verlorengeht. Wenn wir in den folgenden Kapiteln von Perls sprechen, dann meinen wir nicht Perls, den Menschen, sondern den Schriftsteller, oder noch spezifischer das geschriebene Wort, das er uns hinterließ, und das im Vergleich zu seinem tatsächlichen Einfluss auf die gegenwärtige Psychotherapie nicht sehr umfangreich ist.
Читать дальше