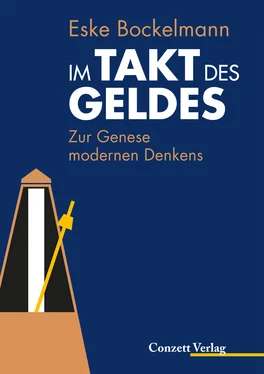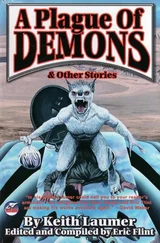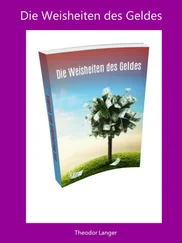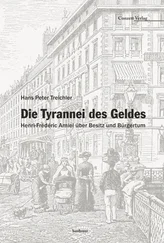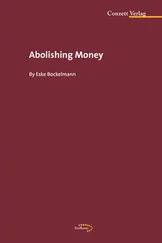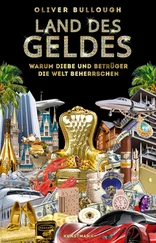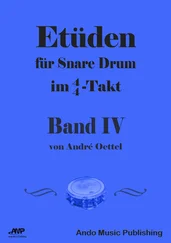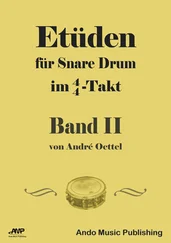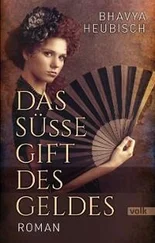Eske Bockelmann - Im Takt des Geldes
Здесь есть возможность читать онлайн «Eske Bockelmann - Im Takt des Geldes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Im Takt des Geldes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Im Takt des Geldes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Im Takt des Geldes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Im Takt des Geldes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Im Takt des Geldes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Und doch sind die Geheimnisse, die darin liegen, tief genug, dass sie selbst den Geheimrat Goethe, einen Großmeister des sprachlichen Rhythmus, in Desperation haben stürzen können. Und nicht, dass sie sich seit seinen Zeiten geklärt hätten. Im Gegenteil, der durchaus klägliche »Stand der Forschung« lautet heutzutage so:
Vorerst muss man sich damit abfinden, dass es eine Übereinkunft über den Begriff des Rhythmus nicht mehr gibt. Das betrifft auch die Termini Metrum, Takt, Periode usw. Sie sind heute unbestimmter und vager, als sie es je zuvor waren. »Es ist bekannt, wie ungeheuer schwer es für uns heute ist (wer wollte es nicht zugeben?), mit diesen Termini richtig zu verfahren, sie objektiv gültig zu interpretieren und gegeneinander abzugrenzen«. Jede Studie über den Gegenstand stimmt dem zu. Und diejenigen, die vorschnell versuchen, aufzuräumen und klarzustellen, vermehren die Unzahl der schon vorhandenen Definitionen um eine weitere. 1
Oder machen sich so davon, dass sie die Frage nach der Rhythmus wahrnehmung , was man als rhythmisch also empfindet , im Namen strenger Wissenschaft einerseits als bloß »populäre« Deutung und andererseits als zu schwierig abtun: »Ein Handicap für die naturwissenschaftliche Forschung ist, dass Rhythmus in populärer Lesart eine subjektive Komponente hat und damit zwangsläufig auf methodisches Glatteis führt.« 2Also weg mit der »subjektiven Komponente« – und Pech für den Rhythmus! Von einer Fläche, die derart rutschig und unsicher ist, heißt es naturwissenschaftlich fernbleiben: Betreten verboten! Wir aber werden uns nun auf diese Fläche begeben – und ich kann den Leser nur ganz in diesem Sinne warnen: Es gibt genug Gelegenheit auszugleiten. Aber man muss nicht stürzen.
Bürgersteig
Das Kapitel »Rhythmus« in Elias Canettis Masse und Macht beginnt so:
Der Rhythmus ist ursprünglich ein Rhythmus der Füße. Jeder Mensch geht, und da er auf zwei Beinen geht und mit seinen Füßen abwechselnd am Boden aufschlägt, da er nur weiterkommt, wenn er immer wieder aufschlägt, entsteht, ob er es beabsichtigt oder nicht, ein rhythmisches Geräusch. Die beiden Füße treten nie mit genau derselben Kraft auf. Der Unterschied zwischen ihnen kann größer oder kleiner sein, je nach persönlicher Anlage oder Laune. Man kann aber auch rascher oder langsamer gehen, man kann laufen, plötzlich stillstehen oder springen.
Immer hat der Mensch auf die Schritte anderer Menschen gehört, er war sicher mehr auf sie bedacht als auf die eigenen. Auch die Tiere hatten ihren wohlvertrauten Gang. Von ihren Rhythmen waren viele reicher und vernehmlicher als die der Menschen. Huftiere flohen in Herden davon wie Regimenter aus lauter Trommlern. Die Kenntnis der Tiere, von denen er umgeben war, die ihn bedrohten und auf die er Jagd machte, war das älteste Wissen des Menschen. Im Rhythmus ihrer Bewegung lernte er sie kennen. Die früheste Schrift, die er lesen lernte, war die der Spuren: Es war eine Art von rhythmischer Notenschrift, die es immer gab; sie prägte sich von selber dem weichen Boden ein, und der Mensch, der sie las, verband mit ihr das Geräusch ihrer Entstehung. 3
Dieses Abenteuer-Idyll muss ich leider stören. Ein Bürger des 20. Jahrhunderts geht auf dem Trottoir, hört das tok tok seiner Absätze und empfindet daran Rhythmus. Unwillkürlich empfindet er es, und so unwillkürlich, wie sich diese Empfindung bei ihm einstellt, so sicher meint er, sie müsse den frühesten und ursprünglichsten Bedingungen der Menschheit entstammen, solchen, die ihn, den Bürger, mit dem Jäger und Sammler prähistorischer Zeiten verbinden, nein, kürzer noch: Bedingungen, »die es« ganz einfach schon »immer gab«.
Das bürgerliche Wissen hält sich ja gerne für »das älteste Wissen des Menschen«. Und allerdings, wo auch gäbe es zu diesem Glauben eher Anlass als beim Rhythmus? Rhythmus zu empfinden wird man ja nicht gelehrt, man bekommt es nicht erst durch Übungen beigebracht, die Empfindung, etwas sei rhythmisch, stellt sich unwillkürlich ein und ist so tiefe, so allernatürlichste Natur, dass man gar nicht umhin kommt, sie deshalb auch den Tiefen der Natur zuzuschreiben. Keine Überlegung, die hinter sie zurückgreifen, kein Gedanke, von dem sie sich ableiten, kein Diskurs, dem sie sich verdanken könnte. Sie lässt sich nur hinnehmen, und gerade darin, dass sie in dieser Weise unhintergehbar ist, liegt ihre strikte Natürlichkeit. Die aber zwingt zu der Überzeugung, sie wäre auch ewig wie die Natur: Das Maß, wie weit zurückliegenden Zeiten sie Canetti deshalb zuschreibt, gibt nur das Maß wieder, wie sehr sie uns natürlich ist. Uneingeschränkt zu allen Zeiten soll es sie so gegeben haben wie für uns – das heißt: So uneingeschränkt ist sie unserer Wahrnehmung a priori .
Daher Canettis Ursprungsmythos vom Rhythmus in seiner ganzen unbekümmerten Ungeschichtlichkeit. Aber noch einmal: Hat das Absehen von Geschichte in diesem Fall, selbst wenn man vielleicht anders konstruieren wollte als mit den Füßen, nicht sein gutes Recht? Gehen wir einmal mit Canetti und setzen voraus, jeder Mensch – Indianer und Old Shatterhand ausgenommen – werde beim Gehen unweigerlich, »ob er es beabsichtigt oder nicht«, ein Geräusch verursachen. Ergibt sich dann nicht wirklich und notwendig, jenseits aller geschichtlichen Entwicklung und Unterschiede, »ein rhythmisches Geräusch«? Sicherlich, laut Voraussetzung, ein Geräusch – was aber macht es zu einem rhythmischen ? Laut Canetti gilt: Das Geräusch ist schon rhythmisch. Es soll seinen Rhythmus als die Eigenschaft, nicht bloß irgendein , sondern rhythmischer Klang zu sein, offenbar fix und fertig in sich tragen, denn eben damit soll es Rhythmus ja »ursprünglich«, wie es heißt, auf die Welt bringen. So die Logik von Canettis Ursprungsmythos: Da entsteht ein Geräusch, und weil dieses Geräusch schon als solches rhythmisch wäre, soll mit ihm zugleich Rhythmus entsprungen sein. Und den Menschen, da sie Geräusch und in ihm Rhythmus hören, würde es auf diese Weise eine »ursprünglich«-erste Kenntnis von Rhythmus einprägen. Nur: Wer hätte die Menschen gelehrt, erst genau dieses Geräusch als rhythmisch zu erkennen und nicht schon das Rauschen der Blätter oder das Plätschern des Bachs?
Wem jetzt die Antwort einfällt: Weil das eine Geräusch rhythmisch ist und die beiden anderen nicht , der eben trifft – wie Canetti selbst – genau die Unterscheidung, die doch erst »ursprünglich« hergeleitet werden soll: Die Bestimmung »rhythmisch« und also die Unterscheidung nach rhythmisch oder nicht sollte das Ergebnis der Herleitung sein und wird es aber nur, indem sie dafür in aller Pracht schon vorausgesetzt wird. Canettis eingängige Herleitung stellt die Dinge ganz einfach auf den Kopf. Die Dinge tragen zwar allerlei Unterschiede an sich, wenn sie auf die Welt kommen und solange sie auf der Welt sind, aber sie geben nicht die kategorialen Unterscheidungen vor, mit denen dann die Menschen sie belegen. Kein Geräusch trägt die Aufschrift mit sich herum: Mich empfinde und beurteile unbedingt als rhythmisch! oder: Mich empfinde und beurteile um Himmels willen keinesfalls als rhythmisch! Eine solche Unterscheidung geht nicht von den Dingen aus, sondern notwendig von den Menschen, die sie vornehmen. Und die Erkenntnis, dass es sich mit dergleichen so verhält, ist inzwischen steinalt; nur just beim Rhythmus hat sie sich noch keinmal einstellen wollen. Seltsam genug.
Indem Canetti von der Entstehung eines spezifisch rhythmischen Klangs schreibt, hat er notwendig die Unterscheidung zwischen rhythmischen und nicht-rhythmischen Geräuschen getroffen, und er muss sie treffen: eben weil unsere Empfindung es tut. Sie nimmt diese Unterscheidung nicht bloß begrifflich, sondern ohne Unterlass real vor, indem sie auf einen Klang, den sie als rhythmisch wahrnimmt, in einer Weise reagiert, die sich bei anderen Klängen nicht einstellt. Deshalb ist kein Ton, kein Geräusch, kein Ereignis je als solches rhythmisch, keines kann es von sich aus sein. Man muss sie schon als rhythmisch empfinden , damit sie überhaupt erst zu Rhythmus werden, nämlich bestimmt werden. Andererseits: Was liegt daran? Ob er jetzt im Klang selbst liegt oder erst des Subjekts bedarf, das ihn dann erst im Klang wahrnimmt – was ist damit gewonnen? Denn eines ist doch ganz sicher nicht zu bestreiten, nämlich dass wir – nur Vorsicht: das »wir« ist ein verfängliches Pronomen –, dass also wir das Geräusch von Schritten tatsächlich als rhythmisch empfinden. Geradeso wie Canetti. Zu fragen ist deshalb vor allem, welche Art von Klang oder Geräusch wir als rhythmisch empfinden. Wodurch ist jener Klang charakterisiert, dass sich bei uns diese Empfindung einstellt – und zwar derart fraglos und »ursprünglich«, dass jedermann die Annahme zwingend erscheint, »der Mensch« und »jeder Mensch« müsse es von den Ursprüngen an stets genauso empfunden haben wie wir?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Im Takt des Geldes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Im Takt des Geldes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Im Takt des Geldes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.