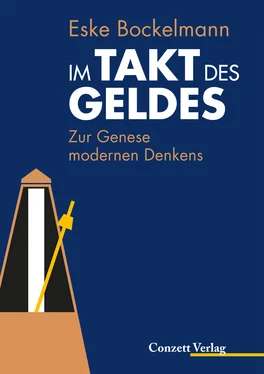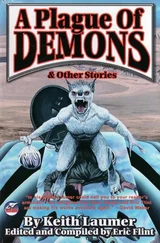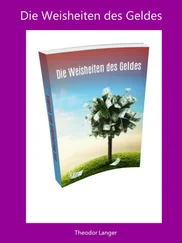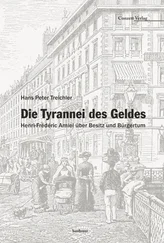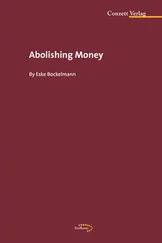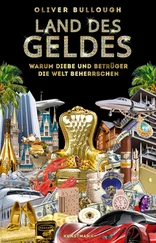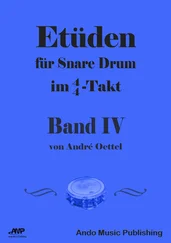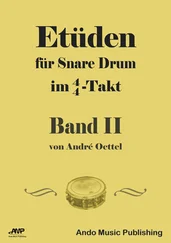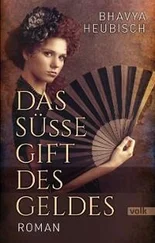Ein staunenswerter Einblick also, den Opitz’ Schrift eröffnet: darauf, wie sich der Taktreflex innerhalb der bereits vorgerückten Lebenszeit eines Menschen durchsetzt und, sobald er sich durchgesetzt hat, damit sofort auch zu unhintergehbarer Natur geworden ist.
Nur ein kurzer Blick noch darauf, wie es damit weitergeht. Opitz’ Poeterey dringt mit ihrer Feststellung, das betont/unbetont sei »hoch von nöthen«, alsbald durch – anders als manche anderen Vorschläge zu veränderter Skansion, die im 16. Jahrhundert ergingen und sang- und klanglos untergegangen waren. Sehr rasch und ganz allgemein werden seitdem im Deutschen Akzentverse gedichtet, und das kann nur sein, wenn jenes »Sollen« tatsächlich so, wie es Opitz gedankenlos voraussetzte, allgemein schon stark genug empfunden wurde. Noch nicht völlig und ausnahmslos allgemein, denn einem bedeutenden und gefeierten Dichter wie Rudolf Georg Weckherlin will die neue Notwendigkeit Jahrzehnte lang nicht einleuchten – bis schließlich auch er sich daran macht, seine älteren Verse für eine Neuausgabe entsprechend umzuarbeiten. Der Reflex also wird allgemein, und unwiderstehlich werden die Zeugnisse des alten Rhythmus, die älteren Verse, jetzt entweder dem neuen angepasst und nach ihm umgedeutet oder aber sie verfallen dem Verdikt des üblen Klangs. Davon zeugt noch immer ein Schimpfwort wie das von den »Knittelversen«: So hat das 18. Jahrhundert nachträglich die Paarreimverse der Zeit »vor Opitz« verächtlich gemacht – einfach weil diese armen, früher einmal schönen Gebilde sich dem neuzeitlichen Alternieren nach betont und unbetont sperren und da es ihnen nachträglich nur noch mit dem Holzhammer beigebracht werden kann. Und da sie nun schon diesen Schaden leiden, brauchten sie für den Spott, sie würden diesen Knüttel schwingen, nicht zu sorgen.
Opitz führt die Beachtung des Wechsels von betont und unbetont in die deutschen Verse ein, kennt zunächst also nur die elementare Form der Zweier-Gruppe, wenige Jahre später erkennt August Buchner, dass sich mit der neuen Festlegung aufs betont/unbetont auch der »daktylisch« genannte Fall verträgt, dass zu einer Betonten zwei Unbetonte treten, 59und mit dieser Dreier-Gruppe sind die Akzentverse im Deutschen schon fertig so eingeführt, wie es sie noch heute gibt. Ihr Aufkommen hat die Wissenschaft deshalb zu einer Schöpfung von Opitz und Buchner erklärt, zum Ergebnis ihrer Reform . Doch Opitz und Buchner haben sich das neue rhythmische Prinzip und den neuen Versbau, den es verlangt, weder ausgedacht noch auch nur ausdenken können . Geleistet wird beides durch den neu entstandenen Reflex und wäre ohne ihn unmöglich. Opitz und Buchner vermerken lediglich seine Wirkung, entdecken, wie sich ihr Gehör, wie sich ihnen dadurch Klang und Wahrnehmung verändert hat, und werden sich als erste darüber bewusst, wie dem in der Sprachbehandlung beim Dichten nachzukommen ist. Sie geben dem bewusst nach, was ihnen der taktrhythmische Reflex unbewusst vorgibt; aber sie schaffen ihn nicht.
Fragt sich also, was ihn schafft.
Er wirkt in uns, wir finden ihn vor, wir haben ihn hinzunehmen, wie man etwa die Elektrizität hinzunehmen hat. Aber anders als sie, die sich schon zu Urzeiten am Bernstein, dem griechischen elektron feststellen ließ, wirkt dieser Reflex eben nicht zu allen physikalischen Zeiten, sondern erst seit Beginn des 17. Jahrhunderts, und auch das nicht auf einen Schlag überall auf der Welt, sondern zunächst allein in den Gesellschaften des mittleren und westlichen Europa. Also muss er selbst durch etwas geschichtlich bewirkt werden – wodurch?
Was er bewirkt, ist schon jetzt bedeutend genug. Er bestimmt unsere rhythmische Wahrnehmung, unser ganzes natürliches Empfinden für Rhythmus. Auf ihm gründet die gesamte Musik nach Takten, durch ihn allein wird sie zu einer solchen Musik, vom Barock eines Bach bis zum Bum Bum des Techno. Er gibt vor, wie sie rhythmisch zu verlaufen hat, welche Möglichkeiten des Verlaufs es gibt, und dass wir diese als rhythmisch hören. Und nicht nur, dass die Taktmusik jetzt auf ihm gründet, dass er jeweils jetzt die stete und notwendige Voraussetzung ist für das Hören nach Takten, er hat diese Musik weltweit auch durchgesetzt. Auf ihm erhebt sich die Welt der Akzentverse, von Shakespeare bis zu Morgenstern, von Goethe bis zum Rap, er leistet das Versmaß aus betont und unbetont, welches die freien Verse dann allenfalls aufgeben können, er macht – für uns – den Unterschied zwischen Prosa und Vers. Er wirkt in die Sprache, durchwirkt unsere Welt mit der unabsehbaren Vielzahl seiner rhythmischen Alltäglichkeiten, die Wassertropfen fallen durch ihn in Zweier-Gruppen, der Herzschlag will uns seinetwegen rhythmisch klingen und so noch jedes tok tok tok bis hinab zu dem unserer Füße.
Doch er erzeugt nicht nur den unüberblickbaren Reichtum dieser Wahrnehmungen, er erzeugt zugleich das trügerische Bewusstsein , all das wäre bloß objektiv gegebene Natur, ein Bewusstsein, das sich selbst den reflektiertesten Beweisgängen der Wissenschaft fälschend einbeschreibt. So bestimmt der Taktreflex auch unser Denken auf eine recht grundsätzliche Weise und bannt es gerade hier, bei Dingen, die so tief in unser Innerstes reichen, auf einen krud vorkritischen Stand – vorkritisch in dem Sinn, dass das Denken hier weit, weit hinter der Wendung durch Kants Kritiken zurückbleibt. Dort war immerhin erkannt, dass unser Denken seine Gegenstände ganz allgemein nach Bestimmungen fasst, die es nicht schlichtweg in ihnen vorfindet, sondern die es selbst ihnen vorgibt und nach denen es sie zu seinen Gegenständen macht. Kant allerdings – und viele tun es heute noch – hält diese Bestimmungen, die Kategorien, für apriorisch konstant, für transzendental der Geschichte enthoben. Während sich dieses Apriori, von der zutiefst unwillkürlichen Empfindung des Rhythmischen bis zur angestrengt bewusstesten Reflexion darüber, selbst nun als geschichtlich erweist.
Welche Geschichte also bringt es hervor?
Zweites Kapitel
So wie die Seele im Körper wirkt er wie jede Substanz und ist doch selber immateriell; er verleiht Bewegung, und doch kann man nicht sagen, dass er existiert; er bringt Formen hervor, und hat doch selber keine Form; er ist weder Quantität noch Qualität, hat nicht Wo oder Wann, keine Lage und kein Äußeres. Wenn ich sagen wollte, er ist der wesenhafte Schatten von etwas, das nicht ist, würde ich die Sache nicht eher verwirren als sie erklären und Sie und mich nicht in einem tieferen Dunkel zurücklassen als vorher?
Daniel Defoe: An Essay Upon the Public Credit
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.