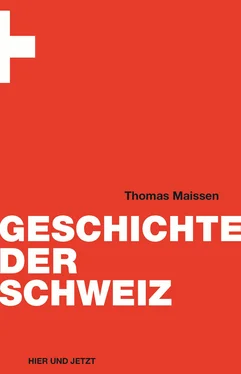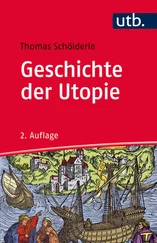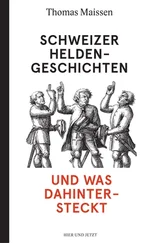Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Maissen - Geschichte der Schweiz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geschichte der Schweiz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geschichte der Schweiz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geschichte der Schweiz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geschichte der Schweiz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geschichte der Schweiz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Strukturell wurde die Stellung des Adels in ganz Europa durch die allgemeine demografische und wirtschaftliche Krise des 14. Jahrhunderts in Frage gestellt. Eine Ursache war das Ende des «mittelalterlichen Klimaoptimums» des 11. bis 13. Jahrhunderts, worauf die Durchschnittstemperaturen sanken. Diese «kleine Eiszeit» sollte bis ins 19. Jahrhundert anhalten. 1322/23 war ein erster extrem kalter Winter, die Ostsee schon im November vereist. Das «Magdalenen-Hochwasser» vom 21./22. Juli 1342, als die halbe normale Jahresregenmenge fiel, überschwemmte auch weite Teile der Schweiz und zerstörte grosse Mengen von Kulturland. Nach weiteren nassen und teilweise extrem kalten Sommern folgte als nächste Katastrophe die aus Asien eingeschleppte Pest, die 1348/49 etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung hinwegraffte und fortan regelmässig wiederkehrte, etwa einmal pro Jahrzehnt. Diese Entwicklung traf den Adel hart, während die Vollbauern ihre relative Stellung insgesamt verbessern konnten. Wegen der Todesfälle nahm ihre Zahl ab, der bebaubare Boden aber nicht, sodass sie bessere Arbeitsbedingungen für ihre gefragten Dienste aushandeln konnten: Abgabenermässigung, Schuldenerlass und Erbleihe mit weitgehend freiem Verfügungsrecht. Widrigenfalls fanden sich Alternativen bei einem anderen Grundherrn oder in den entvölkerten Städten. Insbesondere waren die Bauern nicht bereit, die festgeschriebenen Grundzinsen zu erhöhen, auch wenn sie etwa durch die extensive Viehwirtschaft auf ungenutztem Land höhere Einnahmen erzielten. Die «Realteilung», das heisst die Erbteilung auf die Nachkommen zu gleichen Teilen, schmälerte zusätzlich die Einkünfte einer Grundherrschaft. Von diesen Erträgen hing es aber ab, ob ein Adliger standesgemäss leben, also den Anforderungen eines elitären Lebensstils genügen konnte, der auch wegen Importen des Fernhandels immer mehr kostete. Für die Grundherren tat sich so eine Schere auf zwischen stagnierenden Einnahmen und wachsenden Ausgaben.
Die Zeit der Städtegründungen
Städte waren für die ländliche Gesellschaft sowohl eine Notwendigkeit als auch ein Fremdkörper. Im schweizerischen Mittelland war im Hochmittelalter eine überdurchschnittliche Zahl von ihnen entstanden. Einige Städte gingen auf die (Spät-)Antike zurück und dienten oft als Bischofsresidenzen (Basel, Chur, Konstanz, Genf, Lausanne); andere entstanden um Klöster und königliche Pfalzen (Luzern, St. Gallen, Zürich) herum. Doch die Blütezeit war das 13. Jahrhundert, in dem drei Viertel der 200 Städte gegründet wurden, die es um 1300 gab. Die meisten blieben auf wenige Hundert Einwohner beschränkt; mehr als 5000 zählten Anfang des 14. Jahrhunderts nur Genf, Basel und St. Gallen. Die grossen Stadtgründer im deutschen Südwesten waren die Zähringer: Ihr Stadtrecht für Freiburg im Breisgau hatte Modellcharakter, etwa für Bern und das andere Freiburg, im Üechtland. Dazu kamen, zum Teil als Ausbau von älteren Herrschaftsanlagen, Rheinfelden, Burgdorf, Murten, Thun und Moudon.
Könige, Prälaten oder Adlige hatten als Stadtherren dasselbe Ziel: Sie wollten vom verstärkten wirtschaftlichen Austausch auf den Marktplätzen profitieren, aber auch ein geschütztes Verwaltungszentrum errichten. Eine anhaltend günstige Agrarkonjunktur trug dazu ebenso bei wie der zunehmende Fernhandel, der von der Levante über Italien (Venedig) nach Oberdeutschland oder zu den Messen der Champagne führte. Auf diesen Routen lagen die Bündner Pässe und der Grosse St. Bernhard sowie die beiden Messestädte des Mittellands: Genf und, gleichsam als dessen Aussenstation, Zurzach. Simplon und Gotthard erlangten erst im 14. Jahrhundert mehr Bedeutung. Doch dieses bereitete der städtischen Blütezeit vorerst ein Ende: Die Katastrophen in der Jahrhundertmitte trafen in der Schweiz kurz- und mittelfristig vor allem das Mittelland und dort auch die 200 Klein- und Kleinststädte, von denen die Hälfte zu Dörfern wurde oder ganz verschwand. Doppelt geschlagen wurden die Juden, nicht nur von der Seuche, sondern auch von ihren Nachbarn, welche sie 1348/49 als angebliche Brunnenvergifter mit einem systematischen Pogrom überzogen und ermordeten, zur Konversion zwangen oder vertrieben – womit sie auch ihre Schulden bei jüdischen Geldverleihern getilgt sahen.
Landfrieden gegen Adelsfehden
Der Wohlstand, den die Städte im 13. Jahrhundert erlangt hatten, erlaubte es den Bürgern und konkret den Handwerkerzünften, sich von ihren Stadtherren zu emanzipieren und gemeinsam Ordnungsaufgaben zu übernehmen. Es ging in dieser Zeit ohne eindeutige Staatsmacht um Schutz oder Frieden in dem Sinn, dass Streitigkeiten auf dem Rechtsweg beigelegt wurden und Macht- und Waffenträger auf Gewaltanwendung verzichteten. Diese Forderung betraf in einer stets gewaltbereiten Gesellschaft vor allem die Ritter, die im Prinzip allein dazu legitimiert waren, Fehden mit Blutrachecharakter auszutragen. Mit dieser in einem Absagebrief angekündigten gewaltsamen Selbsthilfe stellten sie (ihr) verletztes Recht wieder her – oder ihre Ehre, was in der Adelskultur kaum voneinander zu trennen war. Entsprechend wurden die feudalen Kleinkriege als private Angelegenheit ausgefochten. Gegen derartige Fehden richtete sich die bereits hochmittelalterliche Landfriedensbewegung, getragen vor allem von der Kirche und den Städten, aber auch von den Fürsten. Sie alle wollten der Eigenmächtigkeit von Kriegsherren und der Eigendynamik von Ehrstreitigkeiten wehren und stattdessen eigene Herrschaftsstrukturen aufbauen. Langfristig arbeiteten sie auf ein obrigkeitliches Gewaltmonopol und rationales Recht hin, indem sie für klar umschriebene Räume und Menschengruppen sowie eine feste Zeitdauer Friedensregeln fixierten. Aussergewöhnlich war die schweizerische Entwicklung nur insofern, als die Einbindung und letztlich Unterordnung des Adels langfristig gelang, ohne dass dafür eine fürstliche Landesherrschaft benötigt wurde, aus der heraus der moderne Staat in der Regel entstehen sollte.
Städte konnten solche weiträumigen Polizeiaufgaben nicht alleine erbringen. Die naheliegende Lösung waren Städtebünde, wie es ihrer im Spätmittelalter viele gab. Besiegelt wurden sie durch einen Eid, weshalb Städtebünde lateinisch coniurationes hiessen: Schwurgemeinschaften von legitimen Herrschaftsträgern zur Verteidigung gemeinsamer Interessen und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Der wechselseitige Schutz und Schirm entsprach dem, was der Adel denen versprach, die ihm einen Treueid schworen, doch geschah es bei Städten eben unter Gleichrangigen. Das Ziel dieser Bünde war aber ähnlich: die Wahrung des Landfriedens – und nicht, wie die Geschichtsschreibung es für die Eidgenossenschaft lange haben wollte, der Freiheit. Freiheit im Singular bedeutete, den vielfältigen Gefahren des Alltags einsam ausgeliefert zu sein. Freiheiten im Plural, iura ac libertates, waren hingegen Privilegien oder (Herrschafts-)Rechte einer ständischen Gruppe.
Städtebünde zur Ordnungswahrung
Die spätmittelalterlichen Städtebünde dienten vor allem dazu, im ausserstädtischen Raum Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, etwa auf den Überlandwegen gegen fehdeführende «Raubritter». Überlokale Rechtsfälle wollte man einvernehmlich und partnerschaftlich angehen, Urteile und Strafen gemeinsam durchsetzen. Im Reich, das keine «Polizei» kannte, aber viele Herrschaftsträger und Gerichte, konnten Übeltäter sonst leicht ihrer Strafe entfliehen. Schiedsgerichte sollten Konflikte zwischen den Verbündeten beilegen, damit keine mächtigen Schlichter anstelle des kaum mehr gegenwärtigen Kaisers eingriffen und die Streitenden nicht nur zur Räson brachten, sondern sie sich gleich ganz unterwarfen. Folgerichtig sagte man sich in solchen Bünden auch gegenseitige Hilfe gegen fremde Bedrohung zu. Nicht zuletzt wollte man damit die städtische «Reichsfreiheit» sichern: Der König als Herr der Reichsstädte war oft versucht, diese an Fürsten zu verpfänden, weil er deren Gefolgschaft oder Geld benötigte. Auch die wirtschaftliche Koordination von Zoll, Münze oder Massen war ein Anliegen vor allem der überlokal tätigen Kaufleute, denen der Landfrieden und die Bündnisse zu dessen Schutz besonders am Herzen lagen. Die Rechtsordnung im Reich war die Voraussetzung der Autonomie, die im Namen Reichsstadt selbst steckte und bedeutete, dem König unmittelbar unterstellt zu sein, keinen anderen Herrn zu haben. Es war deshalb ein Hauptanliegen der Städte, die Reichsordnung selbstständig und miteinander zu gewährleisten, insbesondere in den heiklen Zeiten des Interregnums oder bei dynastischen Wechseln.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geschichte der Schweiz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geschichte der Schweiz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geschichte der Schweiz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.