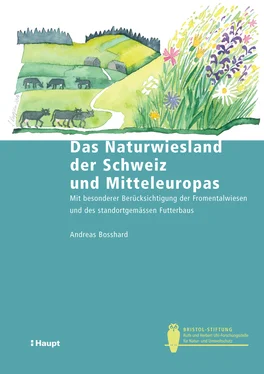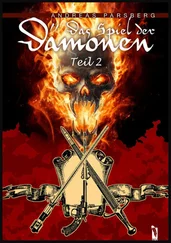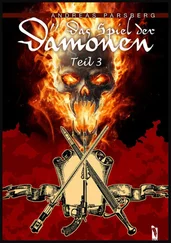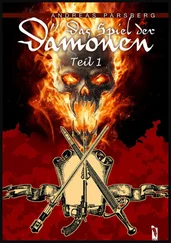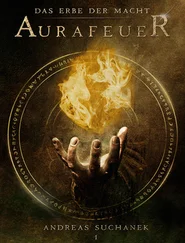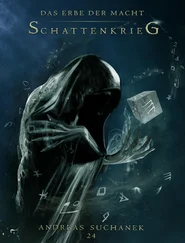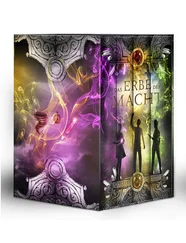An die Stelle der damaligen Fettwiesen sind ertragreichere, aber im Hinblick auf die Biodiversität massiv verarmte Intensivwiesen getreten. Viele ehemals typische und weit verbreitete Pflanzenarten, darunter viele attraktive Wiesenblumen wie Margeriten, Salbei, Glockenblumen oder Flockenblumen, wurden auf Restflächen zurückgedrängt. Heute erreicht in der Schweiz nur noch ein Bruchteil selbst der Ökowiesen die Pflanzenartenvielfalt, welche in den Fettwiesen um 1950 alltäglich war.
Noch stärker waren die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Wieslandfauna. Praktisch alle Tiergruppen, deren Verbreitungsschwerpunkt noch bis in die 1950er Jahre in den Fromentalwiesen lag und die einen Grossteil zur Artenvielfalt der Kulturlandschaft beitrugen, finden in den heutigen Intensivwiesen keine Überlebensmöglichkeiten mehr. Dazu gehören Heuschrecken, Tagfalter, vegetationsbewohnende Spinnen oder bodenbrütende Vogelarten. Ihre Individuenzahlen sind im Wiesland der tieferen Lagen in den letzten 100 Jahren auf noch rund 1 Prozent der damaligen Bestände zusammengebrochen. Bei einigen Tiergruppen sind grossflächig typische Wieslandarten ganz ausgestorben.
Im dritten Teil des Buches ( Teil C
) wird der Frage nachgegangen, welche Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten heute für einen wieder ressourcenschonenderen, standortgemässeren Futterbau existieren und wie beziehungsweise ob sich dieser mit der hohen Bedeutung des Futterbaus für die Erhaltung der Biodiversität Mitteleuropas, aber auch mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten vereinbaren lässt. Umfangreiches Zahlenmaterial weist darauf hin, dass die heutige Nutzungsintensität im Wiesland den wirtschaftlich, ökologisch und für das Tierwohl optimalen Punkt teils bereits deutlich überschritten hat. Dies unabhängig von der Produktionsrichtung, denn der Bioanbau unterscheidet sich im Futterbau nur unwesentlich von der «konventionellen» Landwirtschaft. Ein Schlüsselelement für das Verständnis der Entwicklung und gleichzeitig auch für mögliche Lösungsansätze sind die kritisch zu hinterfragenden, immer höheren Milchleistungen.
Eine der treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung ist die Industrie, welche allein an der Schweizer Landwirtschaft jedes Jahr Milliarden abschöpft, während die Bauern mit der Rindviehhaltung nicht nur nichts mehr verdienen, sondern sogar ein negatives Einkommen generieren. Nur dank den hohen Direktzahlungen vom Staat und einem starken Grenzschutz geht die Rechnung Ende Jahr für die Bauernfamilien noch auf.
Doch es gibt im Hinblick auf eine ressourceneffiziente Wiesennutzung und die Biodiversität im Wiesland auch Lichtblicke. So wurden in den letzten 15 Jahren in der Schweiz mithilfe von Förderprogrammen des Bundes und einiger Kantone Hunderte Hektaren artenreicher Wiesen neu angesät. Damit konnte eine Trendwende im Rückgang der Fromentalwiesen erreicht werden. Mit der aktuellen Reform der Agrarpolitik kamen ab 2014 neue Anreizprogramme dazu, welche die Ressourceneffizienz der Wieslandnutzung verbessern oder den Kraftfuttereinsatz reduzieren helfen können. Seit einigen Jahren werden zudem die Stimmen aus der Forschung und von praktizierenden Landwirten immer prominenter, welche die Hochleistungsstrategie in der Milchproduktion, die für viele der gravierenden wirtschaftlichen und ökologischen Probleme im Futterbau verantwortlich ist, in Frage stellen und mit neuen Wegen in Richtung raufutterbasierter Produktion experimentieren – mit eindrücklichen Win-Win-Effekten.
Aus den dargestellten Fakten und Erfahrungen werden Schlussfolgerungen gezogen, wie ein zukunftsfähiger, die Produktionsbasis erhaltender und fördernder Futterbau auf dem Landwirtschaftsbetrieb und in der übergeordneten Planung aussehen kann. Eine Checkliste, welche ökonomische, futterbauliche, energetische und ökologische Gesichtspunkte miteinbezieht, ermöglicht die Identifikation von gezielten Optimierungsmöglichkeiten im konkreten Einzelfall eines landwirtschaftlichen Betriebes.
Bei einer standortangepassten, differenzierten Wieslandnutzung haben Fromentalund Goldhaferwiesen, also die Fettwiesen der Landwirtschaft bis in die 1950er Jahre, weiterhin einen wichtigen Stellenwert. Sie lassen sich nicht allein als Ökoflächen erhalten und fördern, sondern müssen wieder Bestandteil einer produktiven, nutzungsorientierten, standortgerechten Landwirtschaft werden.
Die Fakten und Beispiele zeigen, dass Ökologie und Ökonomie, Biodiversität und Produktion, Nachhaltigkeit und landwirtschaftliches Einkommen keine Gegensätze sind, sondern im Wiesland Mitteleuropas auch unter den heutigen Bedingungen über weite Strecken in Einklang stehen oder stehen würden, ja mehr noch: unabdingbar zusammen gehören.
Teil A
Ökologische und futterbauliche Grundlagen
Naturwiesen sind ein faszinierendes Zusammenspiel von Kultur und Natur, von Nutzung und Biodiversität. Naturfutterbau ist die einzige landwirtschaftliche Produktion, die fast ausschliesslich Pflanzen der einheimischen Flora nutzt. Ebenfalls im Gegensatz zu allen anderen landwirtschaftlichen Kulturen ist ihre Produktivität nicht durch einzelne Arten, sondern immer durch eine Gemeinschaft zahlreicher verschiedener Pflanzenarten gewährleistet. Das komplexe Zusammenwirken der Vielfalt an Pflanzen-, Tier-, und Mikrooganismenarten zu verstehen und langfristig produktiv zu nutzen, ist eine ebenso anspruchsvolle wie interessante Herausforderung. Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Produktionssystemen wie Ackerbau, Gemüse- oder Obstbau, die auf Monokulturen aufbauen, sind die Möglichkeiten manipulativer Eingriffe, beispielsweise durch Pestizide oder Ansaaten, im Wiesland begrenzt und wirken meist nicht nachhaltig. Teil A Teil A Ökologische und futterbauliche Grundlagen Naturwiesen sind ein faszinierendes Zusammenspiel von Kultur und Natur, von Nutzung und Biodiversität. Naturfutterbau ist die einzige landwirtschaftliche Produktion, die fast ausschliesslich Pflanzen der einheimischen Flora nutzt. Ebenfalls im Gegensatz zu allen anderen landwirtschaftlichen Kulturen ist ihre Produktivität nicht durch einzelne Arten, sondern immer durch eine Gemeinschaft zahlreicher verschiedener Pflanzenarten gewährleistet. Das komplexe Zusammenwirken der Vielfalt an Pflanzen-, Tier-, und Mikrooganismenarten zu verstehen und langfristig produktiv zu nutzen, ist eine ebenso anspruchsvolle wie interessante Herausforderung. Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Produktionssystemen wie Ackerbau, Gemüse- oder Obstbau, die auf Monokulturen aufbauen, sind die Möglichkeiten manipulativer Eingriffe, beispielsweise durch Pestizide oder Ansaaten, im Wiesland begrenzt und wirken meist nicht nachhaltig. Teil A vermittelt einen Überblick über die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Standort, Nutzung und Pflanzenbestand im Wiesland und den daraus resultierenden Steuerungsmöglichkeiten. Abb. 1. Wiesenlandschaft im Zürcher Oberland (CH), geprägt von einem vielfältigen, vergleichsweise noch kleinräumigen Futterbau.
vermittelt einen Überblick über die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Standort, Nutzung und Pflanzenbestand im Wiesland und den daraus resultierenden Steuerungsmöglichkeiten.

Abb. 1. Wiesenlandschaft im Zürcher Oberland (CH), geprägt von einem vielfältigen, vergleichsweise noch kleinräumigen Futterbau.
1 Einführung
1.1 Entstehung, Ziele und Bedeutung des heutigen Naturfutterbaus
In den letzten Jahren des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts umreissen STEBLER und SCHRÖTER (1892) erstmals und mit grosser Klarheit zentrale Fragestellungen, die bis heute Landwirtschaft, Naturschutz und Wissenschaft in Bezug auf das Wiesland der Schweiz und in anderen Ländern mit gemässigtem Klima beschäftigen:
Читать дальше