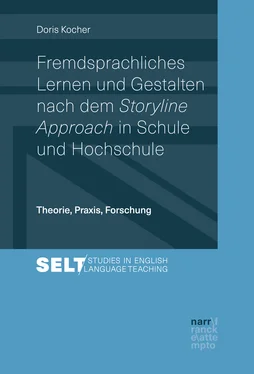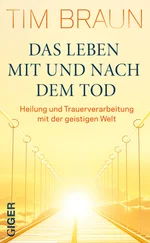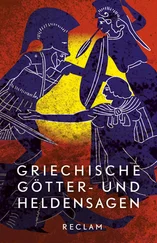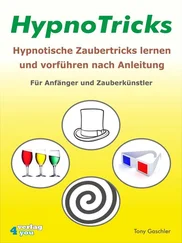In den 1980er Jahren kritisierte die Zweitsprachenerwerbsforschung die Konzeption und Vorgehensweise des vorherrschenden inputorientierten und weitgehend linear verlaufenden Fremdsprachenunterrichts mit seinem vordergründigen focus on forms 1 und sah im Vergleich zu natürlichen und authentischen Lernumgebungen nicht nur Widersprüche, sondern auch deutliche Defizite, was das Sprachkönnen und Interaktionsvermögen der Lernenden anbelangte (vgl. Ellis 2000; 2003). Im Rahmen der einschlägigen Fremdsprachendidaktik wurden schließlich neue Prinzipien und Perspektiven formuliert, die (im Gegensatz zum bisherigen, detailliert strukturierten schulischen Sprachlernen) einen eher naturalistischen Spracherwerb anvisierten. Diese liegen auch dem Konzept des TBL zugrunde und überschneiden sich weitgehend mit den Zielsetzungen und Kernpunkten des Storyline Approach sowie den allgemein formulierten Ansprüchen an eine konstrukti(vistisch)e Lernumgebung (vgl. Kapitel 3.4). Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Kocher 2007; 2016):2
Sprache als Mittel zur authentischen, mitteilungsbezogenen Kommunikation (statt nur Fokus auf deren Form)
Komplexe Aufgaben und bedeutungsvolle Aktivitäten (statt lineare Vorgehensweise, kleinschrittige Sprachübungen und sinnentleerte Drills)
Vielseitige authentische Materialien und Bezug zur außerunterrichtlichen Lebens- und Erfahrungswelt der Lernenden (statt didaktisierte und simplifizierte Texte aus dem Schulbuch, die einer inhaltlichen und grammatischen Progression unterliegen)
Aktiv handelnde und kreative Sprachlernende in einem kommunikativen und realistischen bzw. realitätsnahen Kontext (statt rezeptive und passive Konsumentinnen und Konsumenten)
Lernende als Mitglieder von sozialen Gruppen ( social agents ), in denen durch das gemeinsame Lösen von sinnstiftenden Aufgaben Bedeutungen konstruiert und ausgehandelt werden (statt Still- bzw. Einzelarbeit)
Neue und vielseitige Rollen für Lernende und Lehrende sowie Schaffung einer positiven Lernumgebung (statt Hierarchie, Belehrung und Machtausübung)
Fokus auf die individuellen Lernprozesse (statt einseitige Ergebnisorientierung)
Fokus auf neue Formen der Leistungsmessung und (Selbst-)Evaluation, die nicht nur erkennbare (sprachbezogene) Ergebnisse berücksichtigen, sondern auch individuelle Lernprozesse – und zwar jeglicher Art – einbeziehen (statt eindimensionale Fremdbeurteilung)
Abgesehen von Nunan (1989), Prabhu (1987) und anderen, die bereits in den 1980ern die Rolle von Aufgaben ( tasks ) im Fremdsprachenunterricht erforschten, war es vor allem Jane Willis, die mit ihrer Veröffentlichung A Framework for Task-Based Learning (1996) ein neues Verständnis von Fremdsprachenlernen und -lehren evozierte und den Ansatz einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte. In Deutschland waren es – inspiriert durch Hans-Eberhard Piepho – insbesondere Michael Legutke und Christoph Edelhoff, die den methodischen Ansatz in den frühen 1990er Jahren in der Schule erprobten und weiterentwickelten: Geradezu legendär geworden ist das häufig zitierte Airport Project von Legutke und Thiel (1983).3 In jüngster Zeit wird das TBL-Konzept in Deutschland vorwiegend von Andreas Müller-Hartmann und Marita Schocker-von Ditfurth propagiert. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch in der bildungs- und sprachenpolitischen Diskussion der Aufgabenbegriff verstärkt ins Rampenlicht gerückt ist, und zwar im Zuge der Entwicklung von Kompetenzbeschreibungen für den GER (Europarat 2001) und der Formulierung von nationalen Bildungsstandards.
Nach meiner Recherche stammen die meisten Veröffentlichungen zu TBL – bezogen auf das fremdsprachliche Lernen – aus dem Bereich Englisch als Fremd- bzw. Zweitsprache.4 In Deutschland wird der Ansatz vor allem im Englisch- oder Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht5 eingesetzt und erforscht. Caspari (2006) erwähnt, dass der Ansatz auch in Spanien6 regen Zuspruch erfährt, jedoch „für den französischsprachigen Kontext eine wesentlich geringere Aktivität“ erkennbar ist (Ebd., 34). Im Hinblick auf die diversen Publikationen gewinnt man den Eindruck, dass TBL beinahe rund um den Globus bekannt ist, wenn auch in ganz unterschiedlichen Sprachlernkontexten und konzeptionellen Ausprägungen.7
Bei Task-based Language Learning wird der Fremdsprachenunterricht (wie auch im Rahmen von Storyline -Projekten) auf der Basis von inhaltsorientierten Aufgaben ( tasks ) konzipiert, die sich von den üblichen Sprachübungen ( exercises ) deutlich abheben. Eine der Kernannahmen von TBL lautet, dass durch die Teilnahme an zielgerichteten fremdsprachlichen Interaktionen nicht nur bekannte, sondern auch unbekannte Sprachelemente gelernt werden können, und zwar im Zuge des gemeinsamen Aushandelns von Bedeutungen ( negotiation of meaning ) während der Aufgabenbearbeitung. Anzumerken ist hier jedoch, dass offensichtlich ganz unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, was eine Aufgabe ausmacht, und eine exakte Abgrenzung zu Begriffen wie activity , exercise , drill , test oder auch game scheint schwierig, so dass es sich hierbei wohl eher um einen fließenden Begriff handelt. Hallet und Legutke (2013) bemängeln zu Recht “the terminological fuzziness of the construct“ (Ebd., 3). Stellvertretend werden hier nur Bygate u.a. (2001, 9ff.), Ellis (2003, 2ff.), Samuda/Bygate (2008, 62ff.) und Van den Branden (2006a, 3ff.) genannt, die mehrere und zum Teil sehr unterschiedliche Definitionen von task aufführen und dabei ebenfalls auf die besagte mangelnde Trennschärfe hinweisen.8 So beklagt Van den Branden (2006a), dass “almost anything related to educational activity can now be called a ‘task’“ (Ebd., 3), was auf ein später noch zu thematisierendes Dilemma hinweist.
Was also ist eine Aufgabe? Eine zunächst relativ breite und offene Definition des Aufgabenbegriffs liefern beispielsweise Bygate, Skehan und Swain: “A task is an activity which requires learners to use language, with emphasis on meaning, to obtain an objective“ (Bygate u.a. 2001, 11). Diese Basisdefinition modifizieren die Autoren mehrmals, um sie nach und nach für bestimmte Zwecke zu konkretisieren. Im Vergleich zum Storyline Approach scheint mir jedoch auch diese allgemeine Begriffsbestimmung noch etwas eng gefasst, denn das Bearbeiten von Aufgabenstellungen im Rahmen von Storyline -Projekten erlaubt und integriert neben Sprache (als eines von vielen Kommunikationsmitteln) auch andere und durchaus authentische Ausdrucks- und Darstellungsformen wie Gestik, Mimik, visuelle Darstellungen, Tanz usw., die auf ganz unterschiedliche Art und Weise dem Aushandeln und Vermitteln von Bedeutung dienen können, was schlussendlich eine insgesamt ganzheitlichere Herangehensweise impliziert. Interessanterweise relativiert Skehan seine Aussage später: “This minimalist approach to definition is meant to capture the essential qualities of tasks, i.e. the meaning emphasis and their linkage to an objective“ (Skehan 2007, 291).
Ellis (2003) führt eine Reihe von verschiedenen Kriterien auf, die eine task erfüllen muss. Die folgende Definition scheint in TBL-Fachkreisen als repräsentativ und allgemein anerkannt zu gelten, da sie auffallend häufig zitiert wird: “A task is a workplan. (...) A task involves a primary focus on meaning. (...) A task involves real world processes of language use. (...) A task can involve any of the four language skills. (...) A task engages cognitive processes. (...) A task has a clearly defined communicative outcome“ (Ebd., 9f.).
Auch Nunan (2004, 1ff.) vergleicht eine Reihe von Definitionen, um dabei den Unterschied zwischen so genannten real-world tasks (auch target tasks genannt) und pedagogical tasks zu erklären, wobei er letztere dann wie folgt definiert:
Читать дальше