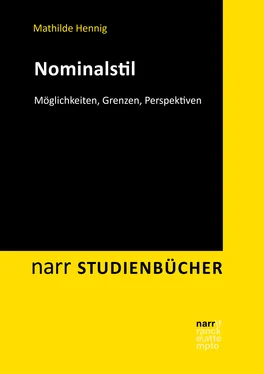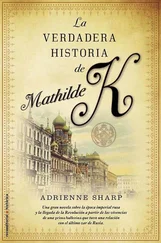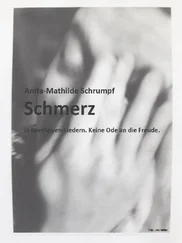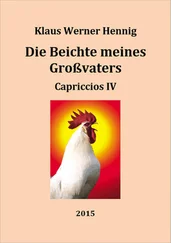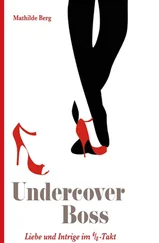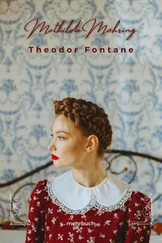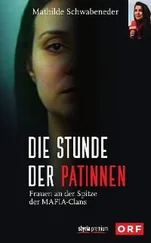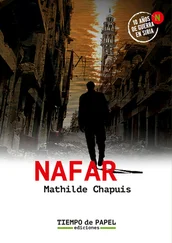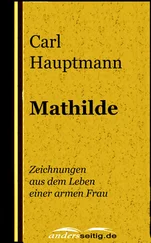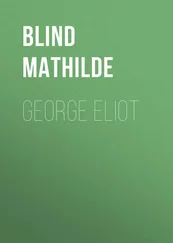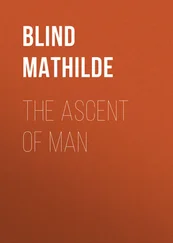Diskurs: Was ist ein Attribut?
Der Begriff des Attributs gehört wie auch der Satzgliedbegriff Satzgliedbegriffzu den zentralen Konzepten der Schulgrammatik. Eine genauere theoretische Betrachtung zeigt jedoch, dass die Antwort auf die Frage, was ein Attribut ist, alles andere als trivial ist. Die hier bereits getroffene Unterscheidung zwischen Attribut, Kopf Kopfund Kern Kernals verschiedene Typen von Wortgruppengliedern Wortgruppengliedbietet bereits eine wichtige Eingrenzung des Attributbegriffs. Hingegen kam es in der Diskussion um den Attributbegriff im 20. Jahrhundert zeitweise auch zu einer Gleichsetzung von Attribut und Gliedteil. Der Terminus ‚Gliedteil‘ wurde von Glinz (1968 [1952]) in die germanistische Linguistik eingeführt; im Grunde genommen war sein Verständnis vergleichbar mit dem, was wir hier Wortgruppenglied nennen (1968: 489). In der Folge ist teilweise ‚Attribut‘ mit ‚Gliedteil‘ gleichgesetzt und auch auf Artikel Artikelausgedehnt worden (Fuhrhop/Thieroff 2005: 313). Diese Entwicklung kann man sehr gut an der Dudengrammatik nachvollziehen: In der vierten Auflage (1984: 592) wurden auch die Artikel den Attributen zugeordnet. In der aktuellen achten Auflage (2016) ist der Possessivartikel Possessivartikelnach wie vor Attribut, weil dieser auch als Aktant Aktant(= ErgänzungErgänzung) fungieren kann (vgl. Sie lacht → ihr Lachen ).
Eine weitere zentrale Frage der Attributdiskussion ist die, auf was sich Attribute beziehen können und was als Attribut in Frage kommt. Einen hervorragenden Überblick über diese Frage bietet der Aufsatz „Was ist ein Attribut?“ von Fuhrhop/Thieroff (2005). Wir können dem entnehmen, dass gegenüber der traditionellen Auffassung, Substantive Substantivseien die Bezugselemente von Attributen, nach heutigem Verständnis im Grunde fast jede Wortart Attribute an sich binden kann (bspw. AdjektivAdjektiv: der sehr begabte Schüler , PronomenPronomen: Ich Idiot , SubjunktorSubjunktor: Kurz bevor er einschlief …; das Attribut ist jeweils fett markiert). Es liegt nahe, dass für unsere Beschäftigung mit Nominalstil nach wie vor das Substantiv/Nomen Nomender zentrale Bezugsbereich von Attributen ist; allerdings können auch durch Attribute erweiterte Adjektive bzw. adjektivisch verwendete Partizipien Partizipstark zum Ausbau von Nominalgruppen beitragen.
Eine zentrale Rolle in der Attributdiskussion spielt auch die Unterscheidung zwischen Komplementen und SupplementenSupplement, also valenzgebundenen valenzgebundenund nicht valenzgebundenen Attributen (Fuhrhop/Thieroff 2005: 325). Das ist für unsere Thematik insofern relevant, als deverbale Nominalisierungen Nominalisierungdeverbalhäufig auch Ergänzungen als Attribute an sich binden, die zur Valenzpotenz Valenzpotenzdes zugrunde liegenden Verbs in einem Satz gehören (bspw. Wir hoffen auf Frieden → unsere Hoffnung auf Frieden ). Für die quasi einem Satzglied analoge Verwendung eines Attributs hat bereits Blatz (1896) den Begriff ‚sekundäres SatzgliedSatzgliedsekundär‘ verwendet (den Hinweis darauf verdanke ich dem Text von Fuhrhop/Thieroff 2005: 310). Ágel spricht in Bezug auf die Wiederverwertung von Satzgliedern als Attribute von ‚RecyclingRecycling‘ (2017).
Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt findet sich im Text von Fuhrhop/Thieroff: Die beiden Autoren weisen darauf hin, dass es nicht selbstverständlich ist, davon auszugehen, dass sich ein Attribut auf ein Wort bezieht. Vielmehr könnte es sich auch auf eine Wortgruppe Wortgruppebeziehen. So komme für die Interpretation des Bezugs von in Buchholz in die Brücke über den Kanal in Buchholz u.a. die Lesart Lesartin Frage, dass sich dieses Attribut auf die gesamte bisherige Nominalgruppe bezieht (also auf die Brücke über den Kanal ) und nicht nur auf Brücke oder Kanal (2005: 330).
Wie genau Attribute in einer Nominalgruppe zu bewerten sind, hängt vom grammatiktheoretischen Kontext der Begriffsbestimmung ab: So ist etwa die folgende Auffassung die Folge des konstituenzgrammatischen Ansatzes von Eisenberg: „Attribute sind unmittelbare KonstituenteKonstituenteunmittelbarn von Nominalgruppen und dem Kernsubstantiv Kernnomennebengeordnet.“ (Eisenberg 2013b: 235) In einem dependenzgrammatischen DependenzgrammatikAnsatz hingegen sind Attribute nicht dem Kernnomen nebengeordnet, sondern hängen von diesem ab (vgl. die Abbildungen 3 und 4).
Wie angekündigt wollen wir uns nun über eine Analyse des bereits zitierten Beispiels einer komplexen Nominalgruppe aus der IdS-Grammatik weiter an den Attributbegriff annähern.
| (5) |
die erste Durchsteigung der Nordwand der großen Zinne auf der Direttissima im Winter 1989 durch Kurt Albert und Gefährten im Rotpunkt-Stil (IdS-Grammatik 1997: 1927) |
Um eine Grundlage für die Interpretation der Bezüge der Attribute zu haben, sei die Nominalgruppe zunächst in einen Satz „übersetzt“:
| (5‘) |
Kurt Albert und Gefährten durchsteigen die Nordwand der großen Zinne auf der Direttissima im Winter 1989 zum ersten Mal im Rotpunkt-Stil. |
Der Umformulierung können wir entnehmen, dass es mehrere Konstituenten gibt, die sich auf das Verb durchsteigen beziehen:
Kurt Albert und Gefährten sind diejenigen, die durchsteigen (= SubjektSubjekt);
die Nordwand wird durchstiegen (= AkkusativobjektAkkusativobjekt):
mit auf der Direttissima wird die Route benannt, auf der die Durchsteigung erfolgt (= lokales AdverbialAdverbial);
mit im Winter 1989 wird der Zeitpunkt der Durchsteigung benannt (= temporales TemporalitätAdverbialAdverbial);
die Durchsteigung erfolgt zum ersten Mal (= Frequenzadverbial);
mit im Rotpunkt-Stil wird die Art und Weise der Durchsteigung beschrieben (modales AdverbialAdverbial).
Diese Satzgliedanalyse ist deshalb ein wichtiger erster Schritt bei der Bestimmung der Attribute, weil wir daraus schlussfolgern können, dass sich all diese „recycletenRecycling“ Attribute auf den Kern Kern Durchsteigung beziehen. Sie sind folglich Attribute ersten Grades. Das Ergebnis ist, dass nur die Nominalgruppe Nominalgruppe der großen Zinne übrigbleibt. Es handelt sich also um ein Attribut zu Nordwand als Kern des ersten Attrib uts ersten Grades. Das Genitivattribut Genitivattribut der großen Zinne ist deshalb ein Attribut zweiten Grades. Das Adjektivattribut Adjektivattribut großen wiederum kann, da es sich auf Zinne als Kern des Attributs zweiten Grades bezieht, als Attribut dritten Grades eingeordnet werden.
Ich wähle im Folgenden zwei Darstellungsformate, mit denen die Beziehungen der Attribute in dieser Nominalgruppe systematisch erfasst und visualisiert werden. Das erste Darstellungsformat ist eine dependenzgrammatische DependenzgrammatikAnalyse in Anlehnung an die Dependenzgrammatik von Eroms (2000), s. Abbildung 3. In dieser Darstellung ist Dependenz Dependenzdaran erkennbar, dass eine (schräg verlaufende) Linie nach unten eingezeichnet ist. Wenn sich mehrere Elemente auf einer Ebene befinden – wir hatten ja bereits festgestellt, dass es in diesem Beispiel mehrere Attribute ersten Grades gibt –, bedeutet das, dass sie auf einer Ebene in der Dependenzstruktur Dependenzstrukturliegen. Die runden Bögen über Det (ArtikelArtikel) und N (NomenNomen) kennzeichnen, dass die beiden Bestandteile einer Nominalgruppe zusammengehören, ohne dass eine Dependenzrelation Dependenzrelationzwischen ihnen besteht. Die gepunkteten Linien ordnen die grammatischen Kategorien Kategoriegrammatischden Wortformen im Beispiel zu. Bei Verschmelzungen aus Präposition Präpositionund Artikel (hier: im ) erfolgt in diesem Studienbuch in der Analyse immer eine Aufteilung in den präpositionalen Teil und den Artikelteil (hier: i und m ), damit beide Teile für die Analyse der Wortgruppengliedfunktionen zur Verfügung stehen.
Читать дальше