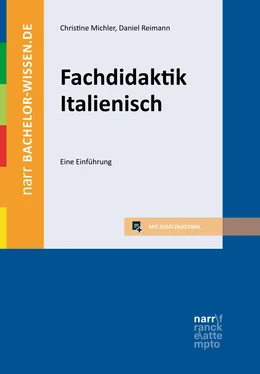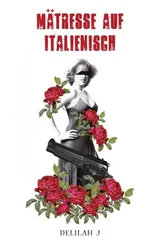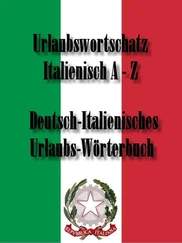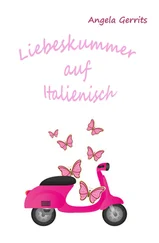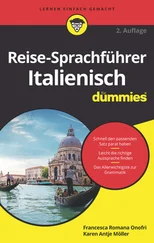ZusammenfassungLehrwerke sind mindestens in der Spracherwerbsphase Grundlage des Italienischunterrichts. Sie sind für Lehrkräfte Orientierungshilfe und Entlastung bei der Arbeit, für Lernende Motivationsträger, die Lernsicherheit geben. Um Mängel der Lehrwerke auszugleichen, ist ein flexibler Umgang mit dem Lehrwerk genauso notwendig wie seine Ergänzung durch zusätzliches Textmaterial bzw. multimediale Komponenten. Problematisch ist das schnelle Veralten v.a. von landeskundlich-kulturellen Inhalten. Trotz der Einwände gegen einen lehrwerkbasierten Unterricht ist ein Abrücken vom Lehrwerk als Leitmedium des Unterrichts in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Eine Hinwendung der im Italienischunterricht verwendeten Lehrwerke zu AufgabenorientierungAufgabenorientierung und KompetenzförderungKompetenzförderung, v.a. Methodenkompetenz durch Lernstrategien und Arbeitstechniken, muss deshalb konsequent erfolgen. Umfassende, auf alle Inhalte und Komponenten bezogene Analysen von Italienischlehrwerken dürfen nicht länger nur ein Desiderat sein, sondern müssen zeitnah realisiert werden.
5.3 | Aufgabenorientierung im Italienischunterricht
AufgabenorientierungAls Folge der Kompetenzförderung (vgl. Einheit 2) verstärkt die aktuelle Fremdsprachendidaktik seit ungefähr den 1980er Jahren die Forderung nach Implementierung von Aufgaben in den Unterricht. Auf dem Konzept des task based language learning (TBLL)task based language learning (TBLL) beruhend (vgl. Ellis 2003; Willis 1996) konnte sich die Aufgabenorientierung zunächst im anglophonen Sprachraum durchsetzen. Spätestens seit die Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts in Deutschland durch die BildungsstandardsBildungsstandards geprägt sind, ist die Aufgabenorientierung auch in Deutschland ein wegweisendes didaktisches Anliegen. In der Unterrichtspraxis konnte sich das Konzept mit seinen „sprachlich und kognitiv anspruchsvolle[n] Aufgaben, die … Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen realer Kommunikation“ vorbereiten sollen (Schinke / Steveker 2013, 4), jedoch noch nicht überall durchsetzen (vgl. S. 76f.).
Zielsetzungen Das Konzept des TBLL zieht Verschiebungen bei den Unterrichtsschwerpunkten nach sich. Die weitgehend übliche „Vermittlung sprachlicher Strukturen in einer gestaffelten ProgressionProgression“ (Schinke / Steveker 2013, 5) sowie die häufig praktizierte Abfolge von „Übungen ohne Wahl“ (z.B. nur Einsetzen der direkten Objektpronomen) mit darauffolgenden „Übungen mit Wahl“ (z.B. Entscheidung zwischen direktem und indirektem Objektpronomen) werden durch die Aufgabenorientierung aufgebrochen, so dass die Konzentration auf Sprachrichtigkeit und die Festlegung auf eine bestimmte Progression in den Hintergrund tritt. Zentral ist nunmehr das Bestreben, Lernprozesse nachhaltig zu gestalten sowie die Verwendbarkeit und mögliche Weiterentwicklung der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler außerhalb und nach der Schulzeit in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu plädiert die Aufgabenorientierung für eine „Einteilung in Vorbereitung der Lernaufgabe ( pre-task ), Arbeit an der Lernaufgabe ( task cycle ) und Spracharbeit ( language focus )“ (Schinke / Steveker 2013, 5; vgl. S 73ff.). Insbesondere Partner- oder Gruppenarbeitsphasen, ganzheitliche Sprachlernprozesse sowie die Förderung der Selbständigkeit und der Selbstverantwortung der Lernenden sollen eine Rolle spielen.
Übung vs. (Lern-)Aufgabe Analog zur Differenzierung zwischen vorkommunikativevorkommunikative Übungsformenn und kommunikativen Übungsformenkommunikative Übungsformen trennt das TBLL zwischen herkömmlicher Übung ( esercizio ) und Aufgabe ( compito ).
Übungen Bei Übungen liegt der Fokus auf der Festigung des korrekten Gebrauchs bestimmter sprachlicher Phänomene ( focus on form; focalizzando sulla correttezza della lingua ). Sie bilden also lautliche, grammatische und lexikalische Kenntnisse und Fertigkeiten (z.B. die Verwendung stimmhafter und stimmloser Laute, von passato prossimo / imperfetto oder den Gebrauch der pronomi combinati ) systematisch mit dem Ziel aus, die sichere Anwendung sprachlicher Strukturen zu gewährleisten (vgl. Leupold 2008, 7).
Die Einübung lexikalischer, grammatischer, orthographischer oder aussprachebezogener Einheiten erfolgt vornehmlich in geschlossenen Übungsformengeschlossene Übungsformen, bei denen es in der Regel nur eine richtige Lösung gibt. Übungsarten sind u.a.: Ausfüllen von Lückentexten, Multiple-choice-Übungen, Einsetzübungen (vgl. Abb. 5.4), Transformationsübungen, in denen vorgegebene Verbformen etwa in Tempus und Numerus verändert werden sollen, Kombinationsübungen, durch die vorher selbständige Einheiten wie zwei Hauptsätze beispielsweise durch Relativpronomen zu einer komplexen Einheit verbunden werden. Auch halboffene Formenhalboffene Übungsformen (z.B. einem Text Informationen entnehmen und sie nach vorgegebenen Gesichtspunkten ordnen) werden gern angewendet. Übungen können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade enthalten, durch Illustrationen, die als visuelle Stimuli überdies oftmals für die Lösung unerlässlich sind, aufgelockert werden und durch PolyvalenzPolyvalenz gleichzeitig zur Festigung verschiedener Inhaltsbereiche (z.B. Aussprache und Wortschatz; Grammatik und Orthographie) herangezogen werden.
Beispiele für Übungen: Come si forma l’imperativo? Completate questa tabella e trovate la regola di formazione (Schmiel / Stöckle 2012, 94); Passato prossimo o imperfetto? Rileggete T2 e compilate la tabella. Presentate la vostra soluzione con esempi del testo (Schmiel / Stöckle 2012, 144).
Aufgaben Die problemlose Anwendung der in Übungen trainierten sprachlichen Inhalte ist Voraussetzung für die Bewältigung von Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern komplexe Aktivitäten verlangen, bei denen die Lernenden sinnvolle, individuelle Lösungen für vorgegebene Probleme finden sollen. Der Fokus liegt auf einer angemessenen, flüssigen, inhaltlich zielgerichteten und möglichst authentischen Sprachverwendung ( focus on meaningfocus on meaning; che si riferisce al contenuto ). Damit sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden, sich in der zielsprachigen Umgebung in komplexen Situationen zu verständigen und handlungsfähig zu sein (vgl. Schinke / Steveker 2013, 4).
Kennzeichnend für Aufgaben sind Handlungs-, Lerner- und Inhaltsorientierung sowie implizite Möglichkeiten für einen offenen Unterricht. Idealerweise besteht bei Aufgaben ein Bezug zur außerschulischen Lebenswirklichkeit der Lernenden, hervorgerufen z.B. durch Rollenspiele, Briefe / Mails an Tourismusbüros, Kontakt zu Musikgruppen, zu italienischen Schülerinnen und Schülern oder der Entwurf von Stadtführungen für eine italienische Austauschgruppe (Wegbeschreibungen, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten usw.). Indem die Lernenden kreativ mit den verfügbaren sprachlichen Mitteln umgehen, erarbeiten sie ein inhaltliches Produkt, zu dem es verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt (vgl. z.B. Una festa di compleanno ; www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GYM_It3_8_Itspb_10_GR_Festa_di_compleanno.pdf; 07.07.2018).
| Übungen |
Aufgaben |
| Schwerpunkt auf der sprachlichen Form einer Äußerung mit dem primären Ziel der Festigung sprachlicher Systeme |
Schwerpunkt auf dem Inhalt einer Äußerung |
| formal korrekter Sprachgebrauch im Vordergrund |
inhaltlich korrekter Sprachgebrauch im Vordergrund |
| oft konstruierte Sprechsituation |
realitätsnahe Sprache, so dass eine authentische Kommunikation möglich ist |
| Sprache selten authentisch |
Betonung von Mitdenken und Selbständigkeit des Lernenden |
| starke Steuerung |
flexible Durchführung |
| Festlegung der Lernenden auf bestimmte Lösungswege |
Förderung des aktiven Problemlösungsverhaltens, keine vorgefertigten Lösungswege |
| eng definierte Lernziele |
sprachliches Lernen geschieht „beiläufig“ |
| Rolle als Lerner im Vordergrund |
Rolle als Sprachanwender im Vordergrund |
Tab. 5.1
Читать дальше