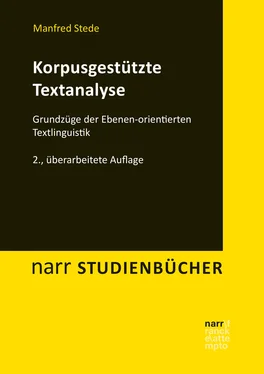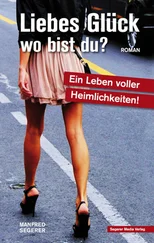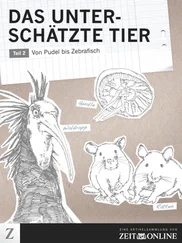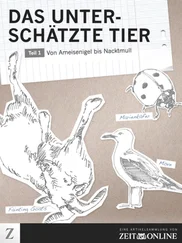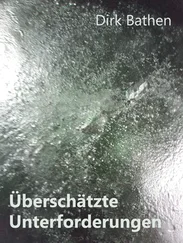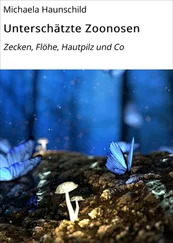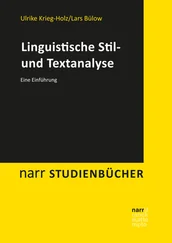EllipsenEllipse ähneln den Pro-Formen, wobei aber das anaphorische Element hier eine „Leerstelle“ ist. Soll eine Ellipse zu Analysezwecken im Text markiert werden, ist dafür das Symbol ∅ gebräuchlich. Zu unterscheiden sind Substantiv-Ellipsen ( Maria trinkt Kaffee mit Milch. Mir schmeckt schwarzer ∅ besser. ) und Verb-Ellipsen ( Maria trinkt Kaffee mit Milch, und ich ∅ einen Tee. ). Im Deutschen ersetzt Elision auch die im Englischen gebräuchliche ‚one-anaphora‘, wobei dann keine Referenzidentität zwischen den Objekten besteht: Diese Kekse sind hart. Wir brauchen frische ∅.
Bußmann (2002) weist darauf hin, dass nicht alle Ellipsen kohäsionsstiftend sind, weil bestimmte Typen syntaktisch motiviert sind. Dazu zählen lexikalische Ellipsen, in denen ein Argument des Verbs qua Weltwissen vom Rezipienten ergänzt wird ( Er isst gerade / Die Hühner legen gerade ), Infinitivkonstruktionen ( Luise hat aufgehört zu rauchen ) und Subjekt-Elision in Imperativsätzen ( Geh nach Hause! ).
Referenzunabhängige lexikalische Assoziation:Die zuletzt besprochenen Phänomene beruhen auf Koreferenz, also auf identischem Bezug der kohäsiv verbundenen Ausdrücke zur „Welt“. Zwischen Lexemen können aber auch referenzunabhängige Assoziationen bestehen, wie oben mit Beispiel 2.3für den Fall identischer Wörter illustriert. Dies lässt sich zunächst ausdehnen auf Wörter unterschiedlicher Wortart, die aber morphologisch und semantisch eng verwandt sind, wie Mensch und menschlich .
Ein nächster Schritt der Ausweitung führt zu den Synonymen, also nahezu bedeutungsgleichen Wörtern oder Phrasen wie etwa sehr groß / riesig . Synonym-Verwendung kann mit Koreferenz einhergehen (s.o. Substitution), muss es aber nicht tun. Kohäsion entsteht des Weiteren auch durch den Gebrauch von Wörtern mit gegensätzlicher Bedeutung, die sog. Antonyme. Diese können einander morphologisch ähnlich sein ( gesund / ungesund ), müssen es aber nicht ( laut / leise ).
Der am schwierigsten abgrenzbare Bereich lexikalischer Assoziation umfasst schließlich eine Verwandtschaft, wie sie manchmal mit dem Begriff Wortfeldumschrieben wird. Es lässt sich etwa argumentieren, dass zwischen Lehrer und Klasse eine kohäsive Verbindung geschaffen wird, oder zwischen Konzert und Dirigent , ohne dass eine der bisher genannten (klarer zu bestimmenden) lexikalischen Relationen vorliegt. Für die Zugehörigkeit zu einem Wortfeld lassen sich kaum präzise Kriterien angeben; hier ist man auf subjektive Beurteilung angewiesen.
Metakommunikative Verknüpfungbesteht dort, wo der Produzent im Text über den Text spricht, z.B. in Überschriften, Gliederungshinweisen und formelhaften Rückverweisen: im Folgenden; vgl. Abschnitt 3; wie oben bereits angedeutet; wie soeben dargelegt; …
Tempus Tempus und ModusModus werden von Zifonun (2000, S. 315) so charakterisiert: „Die Tempora situieren oder lokalisieren die Proposition im Zeitablauf […]. Die Modi tragen dazu bei, die Proposition in einer ‚Welt‘ zu lokalisieren; sie signalisieren also, ob die Proposition bezogen auf die […] wirkliche Welt interpretiert werden soll oder nur auf eine ‚mögliche Welt‘, wie wir sie zum Beispiel in unseren Hoffnungen, Befürchtungen, Wünschen und Plänen konzipieren.“ Gemeinhin wird diesen Merkmalen nur eine geringe kohäsive Kraft zugeschrieben, doch ist die Einhaltung der Regeln der zeitlichen Abfolge (als Ausweitung der consecutio temporumim komplexen Satz) durchaus ein auf der Textebene angesiedeltes, die Kohärenz sicherndes Instrument.
KonnektorenKonnektor gelten neben Pro-Formen als KohäsionsmittelKohäsion „par excellence“, da sie ganz explizit eine Verbindung zwischen Texteinheiten herstellen. Die Art der Verbindung kann dabei recht klar ( obwohl ) oder auch nur vage ( und ) sein. Syntaktisch sind Konnektoren keine homogene Klasse, sondern teilen sich in subordinierende und koordinierende Konjunktionen, einige Präpositionen ( trotz, wegen ), Konjunktional- und andere Adverbien. Auch die Abgrenzung der Gruppe der Konnektoren ist nicht immer ganz einfach, etwa zur metakommunikativen Verknüpfung in Fällen, wo ein Konnektor nicht textexterne Sachverhalte verknüpft, sondern textinterne Objekte. Halliday u. Hasan (1989) nennen das Beispiel He is really a good fellow. First, he‘s honest; next, he‘s generous.
Formgebende strukturelle Mittelsind verschiedene rhetorische Figuren im Satzbau, die kohäsiv wirken; ein bekanntes Beispiel ist die bewusste Wahl paralleler Satzstrukturen, z.B. um Gegensätze herauszustellen: Vor zwei Wochen hat Susanne aufgehört zu rauchen. Und in vier Monaten wird sie wohl anfangen zu joggen.
Zu beachten ist, dass die aufgelisteten kohäsiven Mittel nicht alle im gleichen Sinne ‚Mittel‘ sind, d.h. von der Autorin bewusst eingesetzte ‚Mittel zum Zweck‘. Auf der einen Seite wird beispielsweise eine parallele Satzstruktur oder eine andere rhetorische Figur bei der Textproduktion im besten Sinne des Wortes gewählt , denn es gäbe auch alternative Formulierungsmöglichkeiten, die auf einen solchen rhetorischen Effekt verzichten. Auf der anderen Seite sind Phänomene wie die Koreferenz oder die lexikalische Assoziation quasi unvermeidliche Resultate, sobald ein thematisch zusammenhängender Text bearbeitet wird: Die Sätze des Textes behandeln verwandte Gegenstände, und dazu verwenden sie zwangsläufig Wörter, die in bestimmten semantischen Relationen zueinander stehen. In dieser Weise wären die verschiedenen genannten Kategorien noch einmal daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie jeweils aus einer Auswahlentscheidung der Autorin hervorgehen oder nicht.
Diese Auswahl betrifft häufig auch die Frage, inwieweit eine bestimmte semantische Relation durch lexikalische Wahl (aus den offenen Wortklassen) oder durch kohäsive Mittel markiert ist. Das Spektrum der Möglichkeiten wird von (Kunz u.a., 2017, S. 275) mit diesen englischen Beispielen für den Ausdruck einer temporalen Abfolge zweier Ereignisse illustriert:
(2.4) The performance was followed by a round of applause.
(2.5) After the performance, there was a round of applause.
(2.6) After the performance ended, there was a round of applause.
(2.7) The performance ended. Afterwards , there was a round of applause.
(2.8) [There was the performance.] After the event, there was a round of applause.
2.2.2 Der Wirkungsbereich der Kohäsion
Das Wort ‚Kohäsion‘ legt es bereits nahe, aber wir wollen noch einmal betonen, dass es sich um ein relationalesPhänomen handelt: Kohäsion wirkt nicht dadurch, dass an bestimmten Stellen des Textes ein bestimmtes Merkmal auftritt, sondern dadurch, dass dieses Merkmal eine Verbindung zu einer früheren Textstelle schafft. Ganz offensichtlich ist dies bei Pronomen und Ellipsen, aber ebenso gilt es für die anderen besprochenen Phänomene. In den Worten von Halliday u. Hasan (1989, S. 11): „Where the interpretation of any item in the discourse requires making reference to some other item in the discourse, there is cohesion.“ Dieses sehr allgemeine „making reference“ haben wir im vorigen Abschnitt in eine Reihe von Kategorien aufgegliedert und damit bereits etwas genauer beschrieben. Neben dieser Sortierung der unterschiedlichen Mittel wird sich unser Interesse später darauf richten, was genau mit all diesen Mitteln im Text erreicht wird, d.h. welche Effekte Kohäsionsmittel für die Wahrnehmung des Textes als strukturiertes Gebilde haben.
Читать дальше