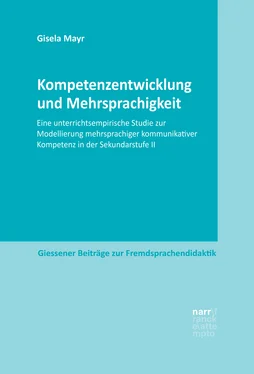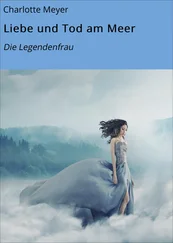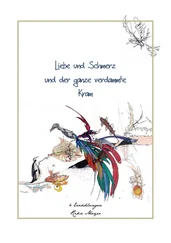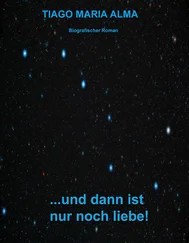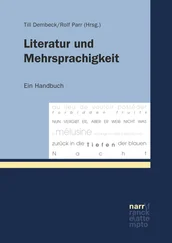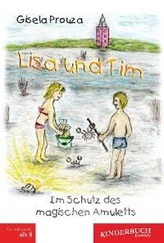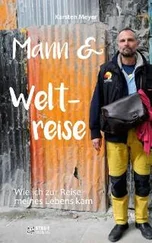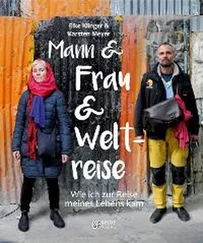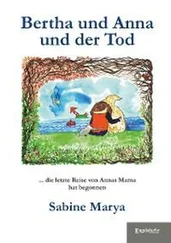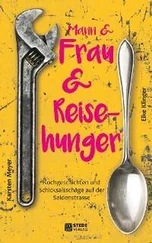In den Rahmenstrategien für Mehrsprachigkeit wird auch das Bewusstsein für Sprachenvielfalt in seiner Bedeutung für die Vermittlung transkultureller Werte und der Teilhabe am mehrsprachigen sozialen Diskurs hervorgehoben. Die durch Migration und Transmigration veränderte Gesellschaft kann sich nicht mehr auf monolinguale Gewohnheiten und Gesprächspraktiken stützen, sondern muss ihren Diskurs den neuen Erfordernissen einer nunmehr mehrsprachigen Gesellschaft anpassen. Das Bewusstsein dafür soll besonders in jungen Menschen gestärkt werden, da es eine aktive Teilhabe an den gemeinschaftlichen sozialen und politischen Prozessen ermöglicht, die in ein mehrsprachiges Umfeld eingebettet und vielfach durch einen mehrsprachigen Ablauf gekennzeichnet sind. Die Bewältigung mehrsprachiger politischer und sozialer Prozesse erfordert ein Wissen um transkulturelle Werte und Kompetenzen, die situationsgebunden strategisch zum Einsatz gebracht werden können und sich in vielfacher Weise von einsprachigen unterscheiden.
Um diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozess aktiv zu begleiten, wären didaktische und pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, die auf die neuen lernpsychologischen Umstände eingehen. Auch die im Unterricht angebotenen Sprachen sowie deren Reihenfolge wären neu zu überdenken. Insbesondere wäre es wichtig, im Sprachenunterricht von den Ausgangssprachen der einzelnen Schüler auszugehen. Folglich muss Unterricht, soll er die Grundlage für eine pluralistische Gesellschaft sein, in der junge Menschen sich zurechtfinden und gefördert werden, umgedacht werden.
Die Form des Task als Unterrichtsverfahren, wie es in den Unterrichtsmodulen durchgeführt wurde, gibt auf diese Forderungen eine konkrete und didaktisch gut operationalisierbare Antwort, da Task-based teaching (Nunan 2004; Hallet 2006, 2008) sich dadurch auszeichnet, dass die soziale Diskursfähigkeit und der Zuwachs kommunikativer Kompetenzen Ziel des Handelns im Unterricht sind. Es wird im Rahmen der Studie die Frage in den Raum gestellt, welche Kompetenzen, Dispositionen, Strategien und Ressourcen junge Menschen entwickeln sollen, nicht nur um sich in einer mehrsprachigen Lebenswelt zurecht zu finden, sondern auch um einen Lernprozess zu initiieren, der schrittweise auf das Kompetenzniveau der mehrsprachigen Bildungssprache und den damit einhergehenden mehrsprachigen kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen übergeht. In diesem Sinne versteht sich die Studie als wegweisend für die Entwicklung neuer Unterrichtsmethoden, die mehrsprachiges Arbeiten im Sinne des GER in eine komplexe Kompetenzaufgabe einbaut.
2.2 Aktualisierung der Deskriptoren: der CEFR/CV
Der im Januar 2018 erschienene Begleitband zum GER (Council of Europe CEFR/CV 2018) enthält eine Reihe von Erweiterungen und Neuerungen, die den 2001 erschienenen Referenzrahmen aktualisieren und den neuen Anforderungen einer immer pluralistischeren Gesellschaft anpassen sollen. Es wird hier erstmals darauf hingewiesen, dass eine klare Unterscheidung zwischen L1 und L2/Lx nicht möglich ist, da es so unterschiedliche Formen des Sprachenlernens gibt wie (Sprach)lernbiographien und da Sprachen oft parallel erworben werden bzw. Kinder oft zwei oder mehrere Erstsprachen haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Erwerb von L2 und weiteren nachgelernten Sprachen, auch hier gibt es Formen von parallelem Spracherwerb, die eine klare Gliederung nicht zulassen (CEFR/CV: 38).
Besonders hervorzuheben ist ganz im Sinne dieser Studie, dass die Deskriptoren nicht dafür gedacht sind, eine Standardisierung der Lernprozesse im schulischen Alltag voranzutreiben. Es handelt sich vielmehr um ein Instrument, das unterstützende Funktion hat und den Bedürfnissen der Lernenden nachkommen sollte, indem es realweltliche kommunikative Bedürfnisse aufzeichnet. Gleichzeitig soll es auch dazu dienen, qualitativ hochwertige Erziehungsziele auszuformulieren, die Inklusion als Teil des Bildungsprozesses explizit ausformuliert (ibid.: 26, 41). Es geht nicht darum, Lernprozesse zu bewerten und neue Standards aufzustellen, sondern vielmehr sollen die Deskriptoren die Lernenden dabei unterstützen, ausgehend von realen Bedürfnissen, lebensweltlich relevante kommunikative Fähigkeiten zu entwickeln (ibid. 27). Das Absehen von jeglicher Form von Standardisierung zugunsten einer individualisierten Lernbegleitung ist ein besonderes Anliegen dieser Studie und als Grundsatz im italienischen Bildungssystem gesetzlich verankert.
Ganz neu im Vergleich zum GER sind die Deskriptoren im Bereich Mediation (ibid.: 106-125) und Mehrsprachigkeit (ibid.: 159-162). Erstere stellen eine Erweiterung des Verständnisses von Mediation, wie sie im GER ausformuliert wurde, dar. Mediation sieht hier den Lernenden als sozialen Agenten, der im Versuch, Bedeutung zu übertragen, Brücken zwischen den Sprachen baut. Dies geschieht immer dann, wenn in der Kommunikation Raum geschaffen wird für gemeinsames Lernen und für die Ko-Konstruktion von Bedeutung. Das Verständnis von Mediation sieht hier auch Formen des sozialen Lernens vor, bei denen u.a. das Mitteln von Informationen in angemessener Form vorgesehen ist sowie die Fähigkeit, andere dazu zu motivieren, neue Bedeutung zu verstehen oder selbst zu konstruieren (ibid. 103). Erstmals wird auch von emotionaler Intelligenz und Offenheit gesprochen, von emphatischem Verständnis für die Bedürfnisse und Gefühle anderer sowie der Wichtigkeit des Erkennens und Einschätzens unterschiedlicher Kommunikationssituationen (ibid. 106).
Dieser erweiterte Begriff von Mediation überschneidet sich mit den in der vorliegenden Studie identifizierten Kernkategorien Soziales Lernen und Mehrsprachige Gesprächspraktiken . Aspekte wie TL ( Translanguaging ), CS ( Code-switching ) und CM ( Code-mixing ) werden hier allerdings in ihrer Wichtigkeit für den mehrsprachigen und transkulturellen Diskurs nicht erwähnt. Man beschränkt sich vielmehr darauf, unterschiedliche Formen von Mediation vom Schriftlichen ins Mündliche und umgekehrt aufzuzeigen. Besondere Bereiche wie das Erläutern von Graphiken und Daten und das Mitschreiben werden auch anhand von Deskriptoren dargestellt. Erwähnt wird auch der Umgang mit literarischen und kreativen Texten. Hervorzuheben ist hier, dass es sich ausschließlich um rezeptive Kompetenzen handelt und sich auf die Bereiche Persönliche Reaktion auf kreative und literarische Texte und Analyse und Kritik literarischer und kreativer Texte beschränkt. Der aktive kreative Sprachgebrauch hingegen findet keinen Eingang. Außerdem wird der Komplexität der hermeneutischen mehrsprachigen Interaktion mit Texten kaum Rechnung getragen.
Im Bereich der Mediation in der sozialen Interaktion werden unterschiedliche Strategien aufgezeigt, wie ein mehrsprachiger Diskurs gelenkt, unterstützt und verständigungserleichternd geführt werden kann. Diese fallen in der vorliegenden Modellierung MKK mit unterschiedlicher Gewichtung in die Kernkategorie Soziales Lernen , da die Deskriptoren sich ausschließlich auf den schulischen Bereich beziehen und somit mögliche Lernprozesse vorstellen. Da, wie aus der Datenauswertung hervorgeht, alle im CEFR/CV vorgestellten Aspekte der Mediation vorkommen, wird den Lernenden dank des besonderen Aufgabenformats die Möglichkeit gegeben, sich diese anzueignen. Der Bereich Mehrsprachigkeit wird mit lediglich zwei Kompetenzbereichen ( Mehrsprachiges Repertoire und Mehrsprachiges Verständnis ) umschrieben. Diese kommen mit einigen Unterschieden auch in der Modellierung vor (ibid.: 159 und 160).
Auffallend ist, dass auch in den Ergänzungen zum GER der Bereich des Savoir s’engager nicht berücksichtigt wird. Das kulturkritische Bewusstsein und die Fähigkeit, Kulturen durch ein spezifisch kulturwissenschaftliches Vorgehen kritisch zu evaluieren und zu hinterfragen, ist zwar ansatzweise in allen anderen Savoirs enthalten, wird aber auch hier nicht systematisch aufgezeigt. Es ist kein Zufall, dass man besonders im Bereich Literarisches Lernen und kritische Reflexion über literarische und kreative Texte auf Aspekte stößt, die auch dem Savoir s’engager zugeordnet werden könnten (ibid. 116-117). Trotzdem wird sowohl dem Literarischen Lernen als auch dem Savoir s’engager in dieser Überarbeitung nur ein geringer Platz eingeräumt, der bei weitem nicht die Komplexität der Phänomene erfasst, die ein kritisches Verständnis von Mehrsprachigkeit und Transkulturalität besonders im Bereich Literarisches Lernen fordert. Die vorliegende Modellierung stellt u.a. den Versuch dar, einen ersten Vorstoß in dieses noch unerforschte Gebiet zu wagen.
Читать дальше