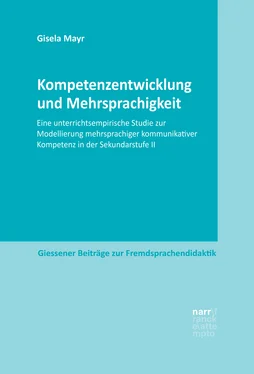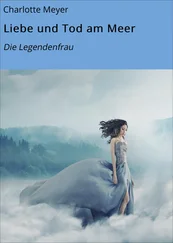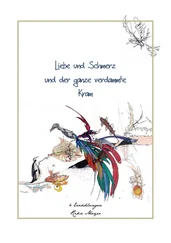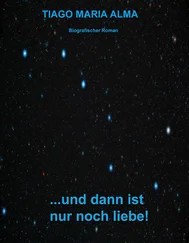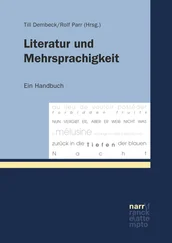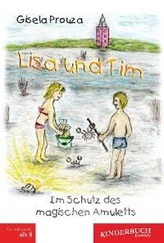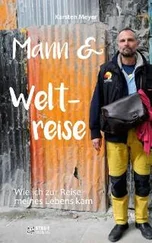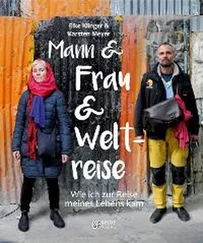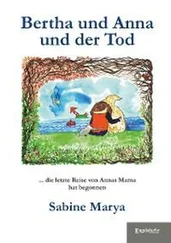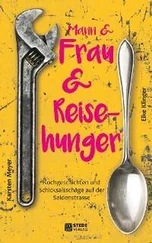Es folgt eine erste Definition von Mehrsprachigkeit (Europarat GER 2001: 17): Dabei wird zunächst zwischen Vielsprachigkeit und Mehrsprachigkeit unterschieden. Vielsprachigkeit greift auf institutioneller Ebene, wie z.B. an Schulen, die ein vielsprachiges Angebot ausarbeiten können, um die Kompetenzen der Lernenden im Bereich Mehrsprachigkeit zu fördern. Mit Mehrsprachigkeit ist die individuelle Erfahrung, der Umgang des Einzelnen mit den Sprachen seines Repertoires und die Erfahrungen der kulturellen Erweiterung, die damit einhergeht, gemeint. Sprachen bilden im Gehirn keine klar voneinander getrennten Einheiten, sondern fächern sich in einer gemeinsamen mehrsprachigen Kompetenz auf. Daher wird von einem parallelen Lernen von Sprachen zugunsten eines synergetisch verstandenen abgesehen. Es sollen sich so gemeinsame, sprachübergreifende Kompetenzen bilden, auf die je nach Bedarf und Kontext zurückgegriffen werden kann. Im Sinne eines lebenslangen Lernprozesses wird Abstand genommen von dem Ideal eines auf muttersprachlichem Niveau zwei- oder dreisprachigen Menschen zugunsten eines Verständnisses von Sprachenlernen, das auch darauf abzielt, sich je nach Bedarf auf den Erwerb von Teilkompetenzen zu beschränken.
So soll die Entwicklung eines sprachlichen Repertoires unterstützt werden, das beim Erwerb weiterer Sprachen oder Teilkompetenzen eine spracherwerbsfördernde und im Idealfall beschleunigende Funktion einnimmt. Die Begriffe „mehrsprachige Kompetenz“ und „sprachliches Repertoire“ werden in diesem Zusammenhang zwar öfter erwähnt, jedoch bleibt eine genauere Definition dieser Begriffe und ihrer Funktion für den Erwerb weiterer Sprachen aus (ibid.: 18f.). Da der Referenzrahmen keine eingehendere Bedeutungserklärung dieser Begrifflichkeiten liefert, fällt es schwer, sich ein vollständiges Bild von der Funktionsweise und der Auswirkung mehrsprachiger Kompetenzen auf den Spracherwerbsprozess zu verschaffen. Es wird lediglich davon gesprochen, dass beim Sprachenlernen die Möglichkeit gegeben werden sollte, diese mehrsprachige Kompetenz zu entwickeln, wobei der Sprachmittlung in all ihren Formen hier eine besondere Wichtigkeit eingeräumt wird. Es werden auch keine Deskriptoren zur Mehrsprachigkeit angeführt. Es fehlt also ein grundlegender Aspekt, der unverzichtbar ist, will man Mehrsprachigkeit im Unterricht implementieren. Was bleibt, ist lediglich eine allgemeine Definition mehrsprachiger Kompetenzen ohne deren Deskriptoren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der GER zwar ansatzweise einige Grundbegriffe der Mehrsprachigkeit ausformuliert hat, dass aber definitorische Unbestimmtheit vorherrscht und es versäumt wurde, den Bereich Mehrsprachigkeit in seinem Facettenreichtum zu erfassen und zu erläutern (GER Kapitel 6).
Einen wichtigen Beitrag hingegen leistet der GER in Bezug auf funktionale Mehrsprachigkeit, indem abgesehen wird von der Vorstellung einer idealen muttersprachlichen Kompetenz in einer Zweitsprache zugunsten der Ausbildung eines möglichst breitgefächerten Repertoires an situationsgebundenen Sprachfertigkeiten in mehreren Sprachen, die je nach Bedarf im Prozess des lebenslangen Lernens ausgebaut und erweitert werden können (ibid.: 132-134). Diese bereichsspezifischen und situationsgebundenen Sprachkompetenzen können gezielt im Unterricht vermittelt oder durch den Sprachgebrauch in Alltagssituationen erworben werden. Die funktionale Mehrsprachigkeit hat allerdings noch nicht ihren Weg in die Bildungsinstitutionen gefunden und es wäre wünschenswert, dass Schulen sich baldmöglichst auf diese neuen gesellschaftlichen Anforderungen einstellen.
2.1.2 Rahmenstrategien zur Mehrsprachigkeit
Nach Fertigstellung des GER konnten in den Folgejahren konkrete Rahmenstrategien für Mehrsprachigkeit ausgearbeitet werden (Council of Europe 2005) und Ansätze mehrsprachiger Erziehung folgten (Council of Europe 2007a,b; 2008a/b/c,). Im Jahr 2008 wurden die ersten Resolutionen über eine gemeinsame europäische Strategie zur Mehrsprachigkeit verabschiedet – dabei handelt es sich um Schlüsseldokumente, die detailliert die Maßnahmen zur Förderung einer mehrsprachigen Bildung vorstellten (Dorner 2008). Auch hier wird auf die Wichtigkeit der Mehrsprachigkeit für die sprachliche und kulturelle Vielfalt innerhalb, aber auch außerhalb Europas hingewiesen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Querschnittsthema“ in Bezug auf Mehrsprachigkeit erstmals erwähnt (Council of Europe 2008a: 1). Dadurch wird Mehrsprachigkeit zum Schnittpunkt nicht nur von Sprachen und Kulturen, sondern auch der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Bildungspolitik sowie allen Bereichen des täglichen Lebens. Von der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit bis zur Bildungssprache sind in der heutigen pluralen und globalisierten Gesellschaft alle Bereiche von Mehrsprachigkeit durchwirkt. Mehrsprachigkeit wird auf diese Weise aus dem sprachen- und kulturübergreifenden Bereich in die alltägliche gesellschaftliche Realität in Europa und außerhalb Europas übertragen. Sie macht die kulturelle Vielfalt der EU aus, und im Zuge des Bewusstwerdungsprozesses darüber soll die Fähigkeit entstehen, das eigene Sprachenrepertoire zu verändern, um es neuen Umständen und Anforderungen anzupassen (Council of Europe 2006). Teil dieses Vorhabens ist auch die Förderung weniger verbreiteter Sprachen, die in diesem Dokument in ihrer kulturellen und sozialen Wichtigkeit unterstrichen wird. Vrings/Vetter bezeichnen Mehrsprachigkeit als eine Schlüsselkompetenz (vgl. Frings & Vetter 2008).
Es wird erstmals festgehalten, dass Mehrsprachigkeit zur Entwicklung von Kreativität beiträgt, indem sie Zugang zu anderen Denkweisen, Weltanschauungen und Ausdrucksformen ermöglicht (Council of Europe 2008b: 2). Dies ist eine für die Zielsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes grundlegende Erkenntnis. Neben der individuell-kognitiven und der sozial-konstruktiven Komponenten von Mehrsprachigkeit wird erstmals die emotional-kreative Komponente angesprochen (vgl. Furlong 2009: 365). Es wird auf die Tatsache verwiesen, dass Mehrsprachigkeit divergentes Denken fördern kann und dass sie in sich den Zugang zu neuen Bedeutungsräumen birgt (vgl. Kharkhurin: 2007: 187). Eine solche Erkenntnis muss unterrichtsmethodische Folgen haben, d.h. innovative Unterrichtsmethoden, welche die Verständigungsbrücken zwischen den Sprachen nicht zuletzt in Form der Übersetzung nutzen, sollten bestärkt werden (vgl. hierzu auch Council of Europe 2014a: 2-3). Als solche versteht sich das in dieser Studie herangezogene Aufgabenformat, das Formen des autonomen und selbstgesteuerten Lernens einen großen Spielraum zugesteht und so Kreativität und originelle Problemlösungswege zulässt.
Neu ist im GER auch, dass besonderes Augenmerk auf den Erwerb der Erstsprache gelegt wird, die unterstützende Funktion für den Erwerb weiterer Sprachen hat. Dabei bezieht man sich auf die Schwellentheorie Cummins (Cummins 1981: 27f.), die besagt, dass kognitive Entwicklung und Sprachkompetenz in enger Beziehung zueinander stehen. Es ist demzufolge eine hohe L1-Kompetenz nötig, damit komplexe kognitive Strukturen auf die nachgelernten Sprachen übertragen werden können. Fehlen diese kognitiven und sprachlichen Strukturen, so können auch Folgesprachen nur auf einem unteren Sprachniveau erworben werden, woraus sich wiederum negative Folgen für die kognitive Entwicklung ergeben. Eine hohe Sprachkompetenz wirkt sich bei Zweisprachigen laut Cummins auch auf die kognitive Entwicklung positiv aus. Die Schwellentheorie ist besonders für die sprachliche Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund relevant, die in den Herkunftssprachen oft ein niedriges Kompetenzniveau mitbringen und daher einer besonderen Förderung bedürfen. Dies gilt in Südtirol teilweise auch für Kinder, die aus einem deutsch-italienisch gemischtsprachigen sozialen Umfeld stammen und in vielen Fällen geringe Sprachkompetenzen in beiden Sprachen aufweisen. Dieser Aspekt wird in der Datenauswertung dieser Studie und der Modellierung einer MKK (Mehrsprachige kommunikative Kompetenz) Erwähnung finden, da sowohl die Sprachbiographie als auch die sprachlichen Kompetenzen der Lernenden in allen Sprachen sich auf die Entwicklung der MKK auswirken. Es hat sich erwiesen, dass die klare Unterscheidung zwischen L1 und L2/Lx in den meisten Fällen nicht möglich ist, da je nach (Sprach)biographie unterschiedliche Formen simultanen Spracherwerbs festgestellt wurden.
Читать дальше