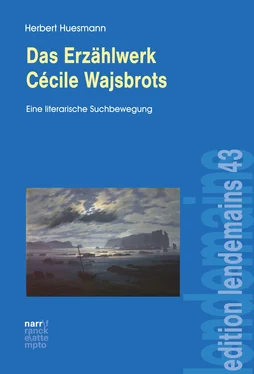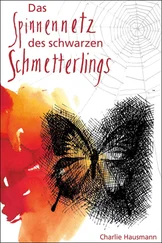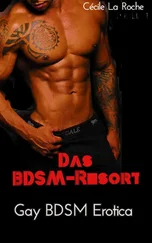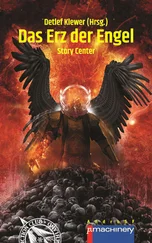1 ...7 8 9 11 12 13 ...35 Cornelia Ruhe betont, dass Lotman unter „Sprache“ in diesem Kontext „[…] nicht nur natürliche Sprache, sondern auch innerhalb einer Kultur geführte Diskurse, bestimmte kulturelle Phänomene [verstehe]“25. Konkret wird er neben bestimmten Fachsprachen oder Fachjargons z.B. auch verschiedene nonverbale künstlerische oder kunsthandwerkliche Ausdrucksformen im Blick gehabt haben, betrachtete er doch ganz offensichtlich auch „Kleidermoden“26 als „Sprachen“. Angesichts der „[…] unterschiedlichen Art und Funktion […]“27 dieser „Sprachen“ und ihrer stark divergierenden Lebensdauer diagnostiziert Lotman Heterogenität als „[…] Kennzeichen der Semiosphäre […]“28, da man bei synchroner Betrachtung immer „[…] verschiedene Sprachen in verschiedenen Entwicklungsstadien […]“ vorfinde.29 Wenn Lotman nun in eben diesem Zusammenhang überraschenderweise „[…] eine einheitliche Welt (der Semiosphäre) im synchronen Schnitt […]“ entdeckt, bedient er sich dabei eines Vergleichs mit einem Museumssaal, in dem „[…] Exponate aus unterschiedlichen Epochen […]“ mit darauf bezogenen Erläuterungen in „[…] bekannten und unbekannten Sprachen […]“ sowie organisierte Rundgänge und kunsthistorische Führungen „[…] einen zusammenhängenden Mechanismus […] und damit die Abbildung einer Semiosphäre ergeben, deren „[…] Elemente […] nicht in einem statischen, sondern in einem beweglichen, dynamischen Verhältnis zueinander stehen […]“.30 Für Lotman ist eine einheitliche Welt also eindeutig nicht eine symmetrisch-gleichförmige, sondern eine asymmetrische, vielfältig strukturierte Welt, in der permanente Prozesse der Übersetzung zwischen verschiedenen „Sprachen“, die „[…] in den meisten Fällen semiotisch asymmetrisch sind […]“, als „[…] Informationsgenerator […]“31 fungieren und damit innovativ-sinnstiftend wirken.
Asymmetrie ist innerhalb der Semiosphäre besonders stark ausgeprägt „[…] im Verhältnis zwischen dem Zentrum und […] ihrer Peripherie“32. Um diese Gesetzmäßigkeit zu verstehen, bedarf es jedoch eines Blickes auf die Grenze als das topologische Hauptmerkmal der Semiosphäre. In deutlicher Abkehr von seinen frühen Schriften, in denen er, wie oben dargelegt wurde, das Prinzip einer strikten Opposition zwischen aneinander grenzenden Räumen vertrat, definiert Lotman die Grenze in Die Innenwelt des Denkens wesentlich differenzierter. Zwar erinnert er an das binäre Modell mit dem Hinweis, dass „[am] Beginn jeder Kultur […] die Einteilung der Welt in einen inneren („eigenen“) und einen äußeren Raum (den der „anderen“) [stehe]“33, als wesentliches Charakteristikum der Grenze bezeichnet er jedoch ihre „Ambivalenz“:
Einerseits trennt sie, andererseits verbindet sie. Eine Grenze grenzt immer an etwas und gehört folglich gleichzeitig zu beiden benachbarten Kulturen, zu beiden aneinandergrenzenden Semiosphären. Die Grenze ist immer zwei- oder mehrsprachig. Sie ist ein Übersetzungsmechanismus, der Texte aus einer fremden Semiotik in die Sprache „unserer eigenen“ Semiotik überträgt; sie ist der Ort, wo das „Äußere“ zum „Inneren“ wird, eine filternde Membran, die die fremden Texte so stark transformiert, dass sie sich in die interne Semiotik der Semiosphäre einfügen […].34
Die Grenze, oder, genauer: der Grenzraum bzw. die Peripherie stellen somit für Lotman einen überaus produktiv-kreativen Bereich dar, in dem aus der dynamischen, oft auch spannungsreichen Begegnung unterschiedlicher „Sprachen“ und der damit notwendigerweise einhergehenden Vermittlung zwischen unterschiedlichen Kodierungen neue Ausdrucksformen („Sprachen“) hervorgehen. Die generative Kraft des Grenzraums könne so stark sein, dass sich im Laufe der Zeit das Verhältnis zwischen Zentrum und Grenze umkehre.35
Das Zentrum hingegen ist der Ort der Semiosphäre, an dem die „[…] am meisten entwickelten und strukturell am stärksten organisierten Sprachen“, also „[i]n erster Linie […] die natürliche Sprache der jeweiligen Kultur“36 dominieren und ihre die Kultur, die Rechts- und Wertvorstellungen einer Gesellschaft normierende Wirkung entfalten. Exemplarisch nennt Lotman den florentinischen Dialekt, der sich während der Renaissance als gesamtitalienische Literatursprache etablierte und, wie hinzuzufügen wäre, im Laufe der Jahrhunderte zur italienischen Hochsprache wurde; die Rechtsnormen, deren Geltungsbereich von Rom aus auf das ganze Imperium ausgeweitet wurde und die, wie einmal mehr zu ergänzen ist, bis heute das Rechtssystem in weiten Teilen Europas und der Welt mit prägen; die Etikette, die vom Hofe Ludwigs XIV. auf die Höfe Europas ausstrahlte.37
Neben den zwischen unterschiedlichen Semiosphären liegenden Grenzen erkennt Lotman jedoch auch Binnengrenzen innerhalb der Semiosphären, durch die „Sub-Semiosphären“ entstehen, deren wechselseitige Beziehung unterschiedlich strukturiert sein kann. Binnengrenzen kommen z.B. durch die in einer Semiosphäre nebeneinander bestehenden Sprachen zustande. Für Lotman kann jedoch auch „[d]ie Grenze der Persönlichkeit […]“ zur „semiotischen Grenze“ werden, wobei der Begriff „Persönlichkeit“ nicht in einer kulturübergreifend einheitlichen Weise interpretiert wird und keineswegs immer „mit den physischen Grenzen des menschlichen Individuums“ übereinstimmt.38
Konsequenterweise geht im Denken Lotmans mit der modifizierten Definition des Begriffs „Grenze“ eine Neudefinition des Sujet-Begriffs und der „beweglichen Figuren“ einher. Statt – wie bisher – von einer einen „inneren“ von einem „äußeren“ Raum trennenden Grenze zu sprechen, die „[…] eine Figur … überschreiten kann“, geht er nun von einer „[…] davon abgeleitete[n], komplexere[n] Situation“ aus. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass statt einer Figur „[…] ein paradigmatisches Bündel von Figuren […]“ auf eine „[…] Untergruppe von personifizierten Hindernissen […]“ bzw. auf „[…] unbewegliche Feind-Figuren […]“ trifft, so dass der „[…] Sujetraum […] mit zahlreichen, auf unterschiedliche Weise miteinander verbundenen oder widerstreitenden Helden „besiedelt“ ist“.39 Die mit der komplexen Wirklichkeit nicht zu vereinbarende, dogmatisch anmutende Rigidität des ursprünglichen Ansatzes wird damit überwunden, die Offenheit des Denkens nachdrücklich unterstrichen.40 Die „bewegliche Figur“ des binären Modells, die eine Grenze zwischen disjunkten Räumen überschreitet, mutiert zu einer „interkulturellen Übersetzerinstanz“ in einer Semiosphäre, die sich durch „[…] die stete Umformung des semiotischen Raumes […]“41 auszeichnet.
Weitaus weniger ergiebig hingegen ist Lotmans Beitrag zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Raum- und Zeitdarstellung in der Kunst und in der Literatur. Zu diesem Thema findet man in seinem Werk allenfalls einige Randbemerkungen.42 Das Interesse der Literaturwissenschaft für diese Problematik wurde unterdessen neu geweckt durch Michail Bachtins Formen der Zeit und des Chronotopos im Roman .43 Die zentralen Gedanken dieser Studie seien daher kurz zusammengefasst.
2.3 Michail Bachtins Theorie der Chronotopoi
In der Einleitung zu Chronotopos kennzeichnet Bachtin das symbiotische Verhältnis zwischen Zeit und Raum „[i]m künstlerisch-literarischen Chronotopos […]“, indem er feststellt, dass „[d]ie Merkmale der Zeit […] sich im Raum [offenbaren], und der Raum […] von der Zeit mit Sinn erfüllt [wird]“1. Gerade auch für den literarischen Bereich sei der Chronotopos „von grundlegender Bedeutung“, allerdings sei „die Zeit das ausschlaggebende Moment“. Das von der Literatur gezeichnete „Bild vom Menschen“ sei immer „chronotopisch“2. Beim Chronotopos ist indes nicht von der „darstellenden realen Welt“ auszugehen, vielmehr bezeichnet der Begriff die vom Autor in seinem Werk geschaffene, modellierte, abgebildete Welt bzw. die vom Hörer/Leser im Rezeptionsprozess „wiedererschaffene“ Welt.3
Читать дальше