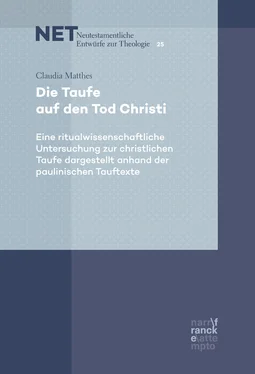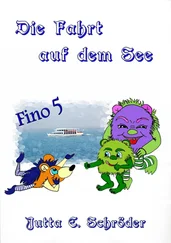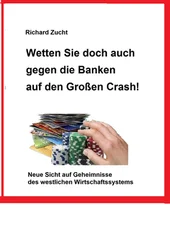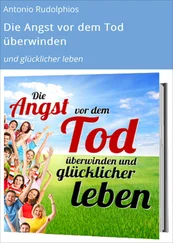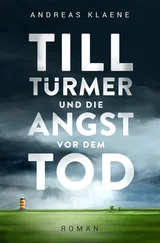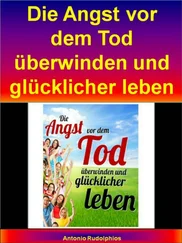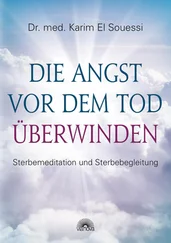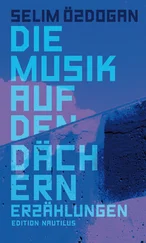2) Selten geht die Ritualveränderung offen und für alle erkennbar vonstatten. Dies hat seine Ursache entweder darin, dass sich ein Ritual unmerklich nach und nach verändert oder aber darin, dass die Veränderung gezielt verschleiert wird: „Neues wird als Altes, Innovation als Tradition ausgegeben.“5 Für religiöse Rituale begründet dies Schwedler folgendermaßen: „Ein von höherer Macht bestätigter und gewollter Kult kann nicht so einfach ‚erneuert‘ werden, ohne in den Verdacht zu geraten, etwas Ursprüngliches und damit Legitimierendes zu verfälschen.“6 Dahingehend stellt sich auch die Frage, inwieweit Neuerungen von allen als solche erkannt und empfunden werden.7
3) Die jeweilige Beschaffenheit eines Rituals hat Einfluss auf dessen Veränderungsprozess. „Dabei spielen etwa ihre Sakralität, ihre zeitliche Frequenz, die Handlungsmacht ihrer Regisseure und vor allem die Art und Weise der Weitergabe eine zentrale Rolle.“8 Während eine rein individuelle mündliche Weitergabe sowie große Zeitspannen zwischen den Ritualvollzügen eine schleichende Veränderung begünstigen, kann die Veränderung eines schriftlich fixierten und von Spezialisten archivierten Rituals nur herbeigeführt werden.9
4) Nicht allein Ritualneuentwicklungen, sondern auch Ritualveränderungen greifen in einem gewissen Maße auf bereits bekannte Ritualelemente bzw. Ritualbausteine zurück. Stollberg-Rilinger betont gar die Notwendigkeit dessen: „Nur so erfüllt sie die Funktion, in Umbruchssituationen, etwa bei der Etablierung eines neuen Regimes, eines neuen Amtes, eines neuen Kultes, eines neuen politischen Programmes usw., von der Legitimität der Tradition zu profitieren und das Neue als weniger neu, gefährlich, beunruhigend und irritierend erscheinen zu lassen.“10 Dies ist dahingehend anzufragen, ob Ritualinnovationen und -veränderungen tatsächlich allein durch die Bewältigungsnotwendigkeit von veränderten Kontexten motiviert sind oder nicht gerade neue Situationen durch Ritualveränderungen geschaffen und gedeutet werden können.
5) Die Bedeutung desjenigen, der ein Ritual verändert, in einen neuen Kontext transferiert, umdeutet oder gar neu entwickelt, ist kaum zu unterschätzen. Bell fasst diejenigen, welche die Autorität haben, Rituale zu leiten, aber auch zu verändern, unter dem Begriff „agency“ zusammen.11 Eine solche Autorität kann abgeleitet sein „[a]us einer göttlichen Quelle, aus institutioneller Autorität, aus gemeinschaftlicher Übereinkunft aufgrund von Aushandlung, aus einer Kombination von all dem“.12 Eine Unterkategorie davon stellen die sog. „founder figures“, wie sie Betz nennt, dar, welche im Zuge von Ritualtransfers Rituale in ihren neuen Kontext einführen, begründen und ggf. die Anpassungen sowie Neuinterpretationen vornehmen.13
Blickt man unter diesen Voraussetzungen auf die christliche Taufe, ergeben sich eine Reihe an Fragen: Handelt es sich dabei tatsächlich um ein neues Ritual, um einen Ritualtransfer oder aber um eine bloße Weiterentwicklung der Johannestaufe? Welche konkreten Kontextveränderungen führen zur Entstehung und Deutung der christlichen Taufe. In welcher Weise reagiert das Ritual auf diese Veränderungen? So fällt etwa die sehr rasche Entwicklung, Verbreitung und Etablierung der christlichen Taufe mit den Entstehungsjahren der ersten christlichen Gemeinden zusammen, deren zwei größten hermeneutischen Herausforderungen die Deutung des gewaltsamen Leidens und Sterbens Jesu Christi sowie der Umgang mit der einsetzenden Heidenmission und damit nichtjüdischen Christusgläubigen sind – zwei Aspekte, welche in grundlegender Weise die christliche Taufe wie auch die ältesten Tauftexte bestimmen. Geradezu ein Paradebeispiel für einen Ritualtransfer stellt später die Verbreitung der christlichen Taufe in der hellenistischen Welt im Rahmen der heidenchristlichen Mission v.a. durch Paulus dar. Betz leitet daraus die These ab: „We are suggesting that the apostle Paul should be viewed as analogous to these Hellenistic founder figures […] The transferral and concomitant re-interpretation of baptism provide us with a classical example of this process.“14 Dies wäre ebenso zu untersuchen wie auch die Frage, auf welche ggf. bereits bekannten Ritualelemente und -deutungen Paulus für seine (Neu-)Interpretation zurückgreift und mit welcher Intention.
1.4 Missverständnisse, Fehler und Protest
Der Ritualablauf kann allerdings auch durch bewusste Verletzungen oder Fehler eine Veränderung erfahren.1 Rehberg spricht sogar davon, es seien wie bei allen Normen erst „die Verletzungen, die Nichtbefolgung, durch welche ihre normative Struktur sichtbar wird.“2 Dies gilt einerseits für die Beteiligten am Ritual: „Oft veranlassen erst Regelverstöße die Akteure dazu, die zugrundeliegende Regel zu thematisieren, die sonst unausgesprochen und selbstverständlich gilt. Erst ein Fehler bringt die Akteure dazu zu reflektieren, inwiefern dadurch die Wirkung des Rituals gefährdet oder zunichte gemacht worden sein könnte.“3 Dabei können über Fehler beim eigentlichen Ritualvollzug hinaus auch Missverständnisse, Unwissen und Fehlverhalten in mit dem Ritual in enger Verbindung stehenden Bereichen oder auch bei korrespondierenden Ritualen zu Beeinträchtigungen oder gar dem Misslingen des ursprünglichen Rituals führen. Gedacht sei etwa an den Vollzug der Beschneidung an Heidenchristen in Galatien, welche für Paulus in direktem Verhältnis bzw. Missverhältnis zu deren christlicher Taufe steht. Andererseits gibt die Analyse derartiger Fehler sowie v.a. des Umgangs mit ihnen Ritualwissenschaftlern ritologische Einsichten in Rituale und deren intendierter Wirkung, welche nicht direkt in den überlieferten Quellen thematisiert und dokumentiert sind. Stollberg-Rilinger weist dabei mit Recht darauf hin, dass die Beurteilung eines möglichen Fehlers zwischen Ritualleiter und Ritualadressaten durchaus unterschiedlich ausfallen kann,4 z.B. abhängig von der jeweils intendierten Ritualwirkung, wie nicht zuletzt die galatische Auseinandersetzung zeigt.
Stollberg-Rilinger listet insgesamt acht verschiedene Arten der Abweichungen bzw. Fehler bei Ritualen5 und Lösungsmöglichkeiten dazu auf:6 1) Das Missgeschick,7 welches entweder taktvoll übersehen; mit einer rituellen Gegenmaßnahme korrigiert oder auch als übernatürlicher Eingriff ausgelegt werden kann; 2) der Konflikt (über den richtigen Ablauf) im Ritual bes. bezüglich Darstellung und damit Herstellung der sozialen Rangordnung der Teilnehmer,8 auf welchen mit Abreise, Protest oder einer Ausnahmeregelung reagiert werden kann; 3) die Abwesenheit von Ritualteilnehmern;9 4) die ironische Distanz von Ritualteilnehmern,10 was die Frage nach dem Verhältnis von äußerlichem Vollzug und innerer Akzeptanz stellt; 5) die Verweigerung der erwarteten Reaktion v.a. in dialogisch angelegten Ritualen;11 6) Entgleisungen durch emotionale Überreaktionen;12 7) die Usurpation oder der Missbrauch als die Störung von außen bzw. die „rituelle Lüge“ eines der Ritualteilnehmer;13 sowie 8) der demonstrative Ritualbruch, der „darauf zielt, die Institution, die das Ritual repräsentiert, grundsätzlich anzugreifen“.14 Stollberg-Rilinger leitet daraus ab: „Wird ein traditionelles Ritual ungestraft entweder ignoriert oder demonstrativ verletzt, dann wird vor aller Augen sichtbar, dass seine performative Kraft […] allein von der Anerkennung der Beteiligten abhängt und dass diese ihm auch entzogen werden kann.“15
Es ist bereits erwähnt worden, dass Ritualkritik einer der wesentlichsten Motoren für die (Weiter-)Entwicklung von Ritualen ist und auch einige der Fehler und Störungen innerhalb von Ritualen – von ironischer Distanz über Verweigerung bis hin zum offenen Ritualbruch – aus der Kritik am Ritual oder seiner Umsetzung entspringen können. Entgegen der landläufigen Meinung, Kritik und Ablehnung von Ritualen seien ein modernes Phänomen,1 lassen sich verschiedene Arten von Kritik und deren Auswirkungen bereits für die Antike belegen,2 was zu der These führt, dass mit jedem Ritual mindestens das Potential zur Ritualkritik gegeben ist.3
Читать дальше