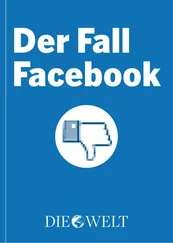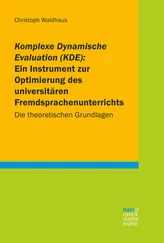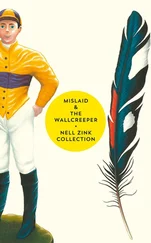Zusammenfassend kann jedoch festgehalten werden, dass CMC positive Auswirkungen auf die Entwicklung sprachlicher Kompetenz haben kann, dass die Wirksamkeit jedoch stark von unterschiedlichen Faktoren abhängt (Heift & Vyatkina, 2017). Für alle CMC-Anwendungen gilt, dass die möglichen positiven Ergebnisse beim interkulturellen Lernen sowie der Förderung von Sprachkompetenzen nicht automatisch mit dem Einsatz von CMC einhergehen. Sie sind dabei auch durch die didaktische und methodische Planung im Vorfeld sowie die reflektierte Betreuung der Lehrkraft bei der Umsetzung bedingt. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sind die gewählten CMC-Aufgaben. Diese sind besonders motivierend für Lernende, wenn sie einen starken Lebensbezug haben, das heißt, wenn sie von sozialer oder professioneller Bedeutung für die Teilnehmenden sind (Warschauer, 1998).
Eine Möglichkeit, CMC-Aufgaben eine Bedeutung zu geben, ist, Lernende aus unterschiedlichen Kursen oder Institutionen mit dem gemeinsamen Ziel, eine Sprache zu lernen oder mehr über kulturelle Hintergründe zu erfahren, miteinander zu verbinden und die Kommunikationsanlässe somit so authentisch wie möglich zu gestalten. Die Umsetzung erfolgt in Virtuellen Austauschprojekten . O’Dowd (2007) definiert einen virtuellen Austausch als eine Aktivität, in der Lernende mit Austauschpartner_innen (anderer Kulturen) in kollaborativer Projektarbeit involviert werden und sich online durch Kommunikationswerkzeuge und Programme wie E-Mails, Videokonferenzen und Diskussionsforen oder, wie in der vorliegenden Arbeit, über Soziale Netzwerke austauschen. In der Fachliteratur gibt es für das Konzept virtueller Austauschprojekte eine Vielzahl von Begriffen, die teilweise synonym verwendet werden, auch wenn sie unterschiedliche Konnotationen haben. Eines dieser Konzepte geht auf die bereits beschriebenen frühen Anfänge des Einsatzes von CMC zurück und wird als Network-Based Language Teaching (Warschauer & Kern, 2000) bezeichnet. Dieser Begriff bezieht sich auf netzwerkbasierte Verbindungen von Computern und wird in den heutigen Studien kaum noch verwendet, da sich vorwiegend internet-basierte Konzepte durchgesetzt haben. Der Terminus Internet-Mediated Intercultural Second Language Education (IC2LE) wird benutzt, um den Gebrauch von CMC-Applikationen im Kontext des Fremdsprachenlernens und dem Austausch mit Lernenden anderer Kulturen zu betonen (Thorne & Black, 2007). Thorne (2006, S. 7-9) beschreibt Telekollaboration , Tandem-Lernen , die Verbindung von lokalen Experten und Expertinnen mit Lernenden und Internet Communities als vier unterschiedliche Modelle innerhalb von IC2LE-Konzepten. Telekollaboration hat sich als Begriff zur Beschreibung von virtuellen Austauschprojekten mit dem Gebrauch von CMC-Anwendungen – vor allem in der englischsprachigen Literatur – durchgesetzt (Schenker, 2012a). Allerdings werden in Deutschland auch Begriffe wie E-Tandems , e-pals , keypals und I nternet-Mediated Communication häufig verwendet, um ähnliche Konzepte oder Projekte zu beschreiben. Jeder dieser Begriffe hat seine eigenen Eigenschaften und Implikationen und hängt von dem Kontext ab, in dem das Konzept eingebettet ist, sowie von der Methodik, die zum Einsatz kommt.
1.6 Telekollaborative Projekte
Für die vorliegende Untersuchung wird mit den Begriffen telekollaboratives Austauschprojekt und Telekollaboration gearbeitet, die in anderen Studien zum Einsatz von Web 2.0-Anwendungen auch Telekollaboration 2.0 genannt werden (Guth & Helm, 2010). Diese Form telekollaborativer Projekte hat sich durch das Aufkommen internet-basierter Kommunikationsformen und der daraus folgenden Weiterentwicklung von Telekollaboration im Fremdsprachenunterricht herausgebildet, deren Anfänge sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen lassen (Müller-Hartmann, 2007).
1.6.1 Überblick über die Entwicklung Telekollaborativer Projekte
Wie beschrieben, lässt sich das Konzept kollaborativer Austauschprojekte im Fremdsprachenunterricht bis in das frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals waren es Freinet (1924) in Frankreich und Lodi (1960) in Italien, die die damals vorhandenen Technologien wie das Druckwesen nutzten, um Inhalte zu erstellen und sich mit anderen Klassen (per Post) auszutauschen (zitiert nach Cummins & Sayers, 1995). Im Jahr 1986 formten dann die Spanischlehrkräfte Solís in Connecticut und Gonsalves in Kalifornien zwischen ihren vierten Klassen eine Partnerschaft und nutzten die Computer im Klassenzimmer, um sich über E-Mail auszutauschen. Die Klassen kollaborierten bei der Erstellung von Zeitungen und tauschten per Post „kulturelle Päckchen“ aus, in denen auch kleine Videobotschaften verschickt und die von den Lernenden „Video-Briefe“ genannt wurden (Cummins & Sayers, 1995).
Kurz nach dem verbreiteten Aufkommen des Internets als Lernmedium in den frühen 1990er Jahren wurden virtuelle Austauschprojekte im Fremdsprachenunterricht vermehrt erprobt und erforscht (O’Dowd, 2011). In den USA berichtete Riel (1992) von einem Projekt, welches von einer amerikanischen Telekommunikationsfirma finanziert wurde und Klassen aus verschiedenen Ländern entsprechend der Klassenstufe und Lehrplanthemen in Gruppen ( Learning Circles ) einteilte und miteinander mit dem Ziel verband, gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten und die Ergebnisse anschließend zu publizieren. Jedoch stellten sowohl die hohen Kosten für Hardware als auch die schlechten Internetanbindungen in Schulen und Hochschulen zu dieser Zeit ein großes Hindernis dar. Deswegen blieb der Einsatz von virtuellen Austauschprojekten bis zur Mitte der 1990er eher eine Seltenheit (O’Dowd, 2011).
Mit der Veröffentlichung Virtual Connections von Warschauer im Jahre 1995 wurde eine Sammlung von Praxisberichten zur virtuellen Vernetzung von Fremdsprachenlernenden veröffentlicht, die deutlich machte, dass sich diese Methode im innovativen kommunikativen Fremdsprachenunterricht langsam etablierte (O’Dowd, 2011). Seither wurden unterschiedliche Modelle virtueller Austauschprojekte unter Anwendungen diverser Aufgabenstellungen, der Nutzung verschiedener Kommunikationsformen sowie der Austausch zwischen verschiedenartigen Partner_innen realisiert und untersucht, was im Forschungskontext von CMC ein weiteres Forschungsfeld eröffnete. Jedoch ist diese Methode bis heute keineswegs fester Bestandteil von Fremdsprachenunterricht, und besonders im universitären Kontext sind virtuelle Austauschprojekte eher selten zu finden (O’Dowd, 2011).
1.6.2 Chancen und Herausforderungen Telekollaborativer Projekte
Telekollaborative Projekte werden oft auch als Virtuelle Austauschprojekte oder Telekollaboration (Belz, 2003; O’Dowd & Ritter, 2006), Internet-mediated Intercultural Foreign Language Education (Belz & Thorne, 2006) oder Online Intercultural Exchange (O'Dowd, 2007) bezeichnet. Aufgrund der vielen verschiedenen Formen, die Telekollaboration annehmen kann, schlägt Dooly (2017) vor, den Begriff zu nutzen, um sprachliche Austausche zu beschreiben, die in formellen Settings umgesetzt werden und diese außen vorlässt, die auf individueller Ebene in dafür designierten Plattformen wie beispielsweise auf Babbel stattfinden. Laut Cunningham (2016) lassen sich die unterschiedlichen Definitionen telekollaborativer Projekte auf die Gemeinsamkeit der Beteiligung von mindestens zwei geographisch voneinander getrennten Parteien zurückführen, die CMC zum Zweck der Förderung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen nutzen.
Argumente für einen Austausch sind oftmals gleichzusetzen mit den Forschungserkenntnissen, die für den Einsatz von CMC sprechen – mit dem Unterschied, dass CMC vor allem in den frühen Einsatzszenarien oftmals kursintern eingesetzt wurde. Bei Telekollaborationen geht es jedoch vorwiegend um die Verbindung von Lernenden anderer Länder oder Kulturen und Muttersprachler_innen. Ein solcher Austausch bietet dem fremdsprachlichen Unterricht viele Vorteile: mehr Kontaktzeit mit der Zielsprache und Übungsmöglichkeiten (Kötter, 2003), erhöhte Lernerautonomie (Donaldson & Kötter, 1999), verstärkte soziale Interaktion mit anderen Lernenden und kognitive Entwicklung (Arnold & Ducate, 2006), gleichberechtigte Lernbeteiligung (Warschauer, 1996b) und Chancen für Bedeutungsaushandlungen (Bower & Kawaguchi, 2011; Kötter, 2003, Schenker, 2015). Der Austausch mit anderen Lernenden kann zu einer Wortschatzerweiterung (Kabata & Edasawa, 2011), verbessertem Leseverständnis, erhöhter pragmatischer Kompetenz (Belz, 2007b; Belz & Kinginger, 2003; Cunningham, 2014, 2016) und einer generellen Verbesserung des Sprachbewusstseins (Vinagre, 2007) führen.
Читать дальше