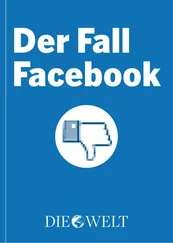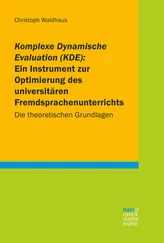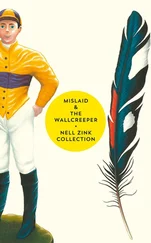Durch die Verbindung von Lernenden mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, ist bei Studien über virtuelle Austauschprojekte die Förderung der interkulturellen Kompetenz und der interkulturellen kommunikativen Kompetenz (ICC) zu einem Schwerpunktthema geworden (Belz, 2007a; Müller-Hartmann, 2000; O’Dowd, 2003, 2011; Ware & Kramsch, 2005; Schenker, 2012a). Ein Konsens besteht darin, dass virtuelle Austauschprojekte bei durchdachter und konzeptionierter Durchführung durchaus zu einem Zuwachs interkultureller kommunikativer Kompetenz führen können.
Neben den zahlreichen Chancen, die telekollaborative Projekte für das Fremdsprachenlernen bietet, gibt es auch diverse Studien, die auf die Nachteile dieser Methode hinweisen. Im Bereich des interkulturellen Lernens wird darauf hingewiesen, dass Missverständnisse nur schlecht aufklärbar sind (Belz, 2001, 2003) und durch die Online-Kommunikation schwierige Themen oftmals besser vermieden werden können als in persönlichen Kommunikationssituationen (Ware, 2003). Hinzu kommen unterschiedliche Anforderungen der Institutionen oder Lehrkräfte an die Lernenden (Belz, 2001; Ware, 2005). O’Dowd und Ritter (2006) benennen vier Ebenen auf denen unterschiedliche Faktoren zu Problemen beitragen: (a) Auf der individuellen Ebene der Lernenden, (b) der unterrichtlichen, (c) institutionellen und (d) auf der Ebene der Interaktion. (a) Auf der individuellen Ebene spielen unterschiedliche Lernvoraussetzungen, unterschiedliche Einstellungen und Unterschiede in der Lernmotivation zwischen Partner_innen sowie unterschiedliche Lernziele zu Spannungen, die von den Lernenden als frustrierend wahrgenommen werden können (Ware, 2005) und zu einem Scheitern der Kommunikation führen können (O’Dowd & Ware, 2006). (b) Die unterrichtliche Ebene beschreibt potenzielle Schwierigkeiten zwischen den kollaborierenden Lehrkräften, den Aufgabenstellungen, der Zusammensetzung der Partner_innen sowie der Gruppendynamik. (c) Auf institutioneller Ebene können sich Unterschiede in Zeit- und Semesterplänen, Präsenzzeit, der Menge an Arbeit für die Lernenden sowie der Evaluation ihrer Leistung problematisch gestalten. (d) Auf der Ebene der Interaktion werden kulturelle Unterschiede in der Art und Weise der Kommunikation wie beispielsweise unterschiedliche Einstellungen zu non-verbaler Kommunikation, dem Gebrauch von Humor und Ironie, identifiziert (O’Dowd & Ritter, 2006). Weitere Herausforderungen liegen in den Unterschieden in der kommunikativen Kompetenz der Teilnehmenden, mangelnde Unterstützung der Institutionen für einen Austausch, mangelnde Zeit der Teilnehmenden zum Erfüllen der Aufgaben sowie unterschiedliche Ziele und Zugänge der beteiligten Lehrpersonen (Helm, 2015). Diese Herausforderungen sollten bedacht werden und können durch eine sorgfältige Planung und Umsetzung größtenteils vermieden werden.
1.6.3 Umsetzung Telekollaborativer Projekte im Fremdsprachenunterricht
Zur Umsetzung im Fremdsprachenunterricht bietet Schenker (2012a) eine Übersicht über die essentiellen Schritte bei der Planung, Durchführung und Evaluation eines Austauschprojektes. Diese beinhaltet Informationen zum Finden von Partner_innen, Auswahl der Kommunikationsmedien und Aufgabenerstellung, Empfehlungen für die Vorbereitung und Durchführung sowie Hinweise zur Evaluation des Austausches (S. 296ff.) Bei der Planung eines telekollaborativen Austauschprojektes sollten an erster Stelle organisatorische Aspekte wie die zeitliche Realisierbarkeit des Projektes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen akademischen Zeitrahmen der teilnehmenden Partnerkurse und ähnliche Anforderungen an beide Teilnehmende bedacht werden. Denn in verschiedenen Studien ist auf die Problematik hingewiesen worden, dass unterschiedliche Anforderungen zu unterschiedlich starker extrinsischer Motivation führt. Dies wiederum kann ein hohes Frustrationspotenzial bei den Teilnehmenden hervorrufen (O’Rourke, 2007; Schenker, 2012a; Ware & O'Dowd, 2008). Zudem muss die Anzahl und das Sprachniveau der Teilnehmenden bedacht werden, insbesondere, wenn Tandem-Aufgaben für den Austausch geplant sind.
Zur Planung und Durchführung geeigneter Austauschkurse gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wobei Schenker (2012a) eine Zusammenarbeit der Lehrkräfte, die auf persönlicher Bekanntheit basiert, als beste Voraussetzung bezeichnet. Weitere Möglichkeiten zum Finden von Partnerkursen benennt sie über diverse Webseiten, wie Epals ( www.epals.com ), Kidlink ( www.kidlink.org ) oder Etwinning ( www.etwinning.net ), auf denen Lehrkräfte entweder – nach bereits bestehenden Gesuchen – unterteilt nach unterschiedlichen Themen, Zielsprachen, Sprachniveaus etc. suchen können, oder selbst Gesuche aufgeben können. Für Kollaborationen in universitären Kontexten wurde die Seite UniCollaboration ( https://uni-collaboration.eu ) eingerichtet. Für das Gelingen eines Austauschprojektes wird in unterschiedlichen Studien die enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte als maßgeblich hervorgehoben (Dooly, 2008; O’Dowd & Ritter, 2006; Schenker, 2012a).
Bei der Durchführung eines telekollaborativen Austauschprojektes sind bei der Auswahl der Medien und Plattformen für die Kommunikation zwischen den Partner_innen zunächst das Lernziel sowie die organisatorischen Aspekte zu bedenken. Beachtet werden muss beispielsweise, ob sich synchrone Kommunikation unter den entsprechenden Umständen realisieren lassen würde, und ob alle Teilnehmenden gleichermaßen Zugang zu internetfähigen Geräten haben, um asynchron oder synchron kommunizieren zu können (Dooly, 2007; Schenker, 2012a). Zudem haben unterschiedliche Applikationen und Kommunikationsformen unterschiedliche Vor- und Nachteile, die vor der Auswahl recherchiert werden sollten. Die Auswahl der Aufgaben ist ein weiterer Aspekt, der ergründet werden sollte, und der stark vom gewählten Modell sowie dem Kommunikationsformat der Telekollaboration abhängt.
Anschließend an die Durchführung sollte eine Evaluation des telekollaborativen Austauschprojektes erfolgen. Die Bewertung auf den Lernzuwachs der Teilnehmenden sowie die Aspekte des Austausches selbst sind wichtige Aspekte, um die Vor- und Nachteile eines bestimmten Designs zu bewerten und nachfolgende Austauschprojekte optimieren zu können (Schenker, 2012a). Für die Evaluation gibt es diverse Möglichkeiten: unter anderem Peer-Assessment, Portfolioarbeit, Fragebogenerhebungen sowie die Bewertung des Outputs oder der Produkte, die durch den Austausch entstanden sind (Schenker, 2012a).
1.6.4 Modelle Telekollaborativer Projekte
In der Theorie haben sich zuerst zwei verschiedene Modelle von Telekollaboration manifestiert (O’Dowd, 2011, S. 369-370). Zum einen existierte das E-Tandem Modell, bei dem zwei Muttersprachler_innen unterschiedlicher Sprachen mit dem Ziel miteinander kommunizieren, jeweils die Sprache der anderen Person zu lernen (O’Rourke, 2007). Die Verbindung zwischen Nicht-Muttersprachler_innen und Muttersprachler_innen (Non-native-speakers – Native-speakers, NNS-NS) war lange Zeit die häufigste Form telekollaborativen Austausches. Das Modell basiert auf den Prinzipien der Lernerautonomie und Reziprozität, wobei die Hauptverantwortung für das Gelingen des Austauschs und für den Lernerfolg bei den Lernenden liegt. Die Tandem-Partner_innen werden zu Peer-Tutoren, korrigieren im Idealfall die Fehler der Nicht-Muttersprachler_innen und bieten alternative Formulierungen in der Zielsprache an. Die Kommunikation läuft entweder synchron (z.B. über Text-Chat) oder asynchron (z.B. über E-Mail) ab und wird üblicherweise zur Hälfte in der Zielsprache und zur anderen Hälfte in der Muttersprache durchgeführt, sodass beide Teilnehmenden vom Austausch gleichermaßen profitieren. In dem Modell des E-Tandems ist die Rolle der Lehrkraft normalerweise minimal, da die Lernenden selbst Verantwortung für ihren Sprachlernprozess übernehmen sollen und sich Themen und Strukturierung oftmals selbst zurechtlegen. Es gibt jedoch auch Forschungsprojekte, die dieses Modell in ein Unterrichtssetting integriert haben und Themenwahl sowie Ablauf des Austausches strukturieren und teilweise auch in den Unterricht einbinden (Kötter, 2003; O’Rourke, 2005).
Читать дальше