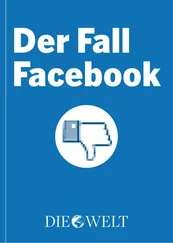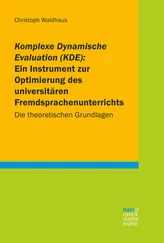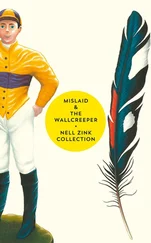Die Input-, Interaktions- und Outputhypothese sind die Basis vieler Forschungsarbeiten im Bereich CMC, wobei die Interaktionshypothese als wichtigste theoretische Grundlage gilt (Chapelle, 2005). Mehrere Studien zeigen, dass Lernende ihre interaktive Kompetenz durch CMC fördern können (Blake, 2000; Chun, 1994; Pellettieri, 2000; Smith, 2003, 2012), indem sie beispielsweise Kommunikationsstrategien anwenden (Lee, 2001, 2002; Smith, 2003) und in synchroner CMC eher linguistische Fehler bemerken und darauf reagieren, als in persönlicher mündlicher Kommunikation (Lai & Zhao, 2006). Dabei beziehen sich viele Studien auf einen Vergleich von synchronen und asynchronen Formaten oder auf einen Vergleich dieser mit persönlicher Kommunikation im Unterricht.
1.3 Synchrone vs. Asynchrone CMC
Bei synchronen Formen von CMC sind alle Kommunikationsteilnehmenden zur gleichen Zeit eingeloggt oder online und können sich in Echtzeit austauschen (Schenker, 2012a). Dies kann entweder durch spezielle Software für lokale Netzwerke (beispielsweise Daedalus Interchange von Daedalus Inc. und Sanako Chat von Tandberg) oder durch Applikationen und Programme, die das Internet nutzen (beispielsweise Skype, MOOs, Soziale Netzwerke), bewerkstelligt werden (Warschauer & Healey, 1998.) Eine beliebte synchrone CMC Form ist das Chatten. Für synchrone CMC haben alle Lernenden einen individuellen Computer, ein Tablet oder Smartphone und verfassen eine Äußerung. Bei schriftlichen und mündlichen Formen muss diese im Anschluss üblicherweise durch das Berühren einer Versenden-Taste abgeschickt werden und ist somit für die anderen Teilnehmenden lesbar oder hörbar. Die Beiträge werden meist in chronologischer Reihenfolge gelistet und können durch das Vor- und Zurückrollen ( scrolling ) bei text-basierten Formen leicht nachvollzogen werden. Synchrone CMC kann mündlich durch Video- oder Audiotelefonie oder Aufnahmen realisiert werden (Guth & Marini-Maio, 2010). Synchrone CMC kann mit Individuen, kleineren Gruppen oder einem ganzen Kurs ausgeführt werden. Für den Einsatz von synchronen Kommunikationsformen muss bedacht werden, dass die Teilnehmenden zur selben Zeit online sein müssen, dies bedeutet Unterschiede in den Zeitzonen und Terminplänen müssen eingeplant werden (Schenker, 2012a). Synchrone CMC ähnelt einer Kommunikation in Echtzeit und ist daher sehr authentisch (Pellettieri, 2000). Zudem bietet sie Möglichkeiten zur kollaborativen Textproduktion und Wissenskonstruktion (Beauvois, 1997; Sotillo, 2000; Warschauer, 1997). Ein Nachteil ist jedoch, dass durch die Augenblicklichkeit der Kommunikation auch hoher Druck auf die Lernenden ausgeübt wird und dies folglich zu Angstgefühlen führen kann (Olaniran, 2009; Rösler, 2007). Studien zeigen jedoch auch, dass im Vergleich zum mündlichen Diskurs bei text-basierter synchroner CMC eher das Gegenteil der Fall ist, da durch das Tippen und die zeitversetzten Antworten mehr Zeit für eine überlegte Antwort gegeben ist (Smith, 2008, 2012).
Asynchrone CMC Formate, in denen die Kommunikation zeitunabhängig erfolgt, sind text-basiert differenzierter und stark abhängig von der gewählten Anwendung (beispielsweise E-Mail, Blogs, Diskussionsforen). Da eine Verzögerung der Äußerungen vorliegt, müssen sich die Kommunikationsteilnehmenden meist erst auf einer Plattform, wie einem E-Mail-Account oder einem Diskussionsforum, einloggen, um die Nachrichten lesen oder hören zu können. Dies kann jedoch auch für synchrone Kommunikationsformen der Fall sein. Ein Vorteil von asynchronen Kommunikationsformen ist, dass diese weniger Absprache zwischen den Kommunikationsteilnehmenden erfordern. Zudem haben Lernende mehr Zeit zum sorgfältigen Verfassen von Texten und dadurch sind die Antworten der Teilnehmenden oftmals besser durchdacht (Schenker, 2012a). Da in asynchronen Formen kein Zeitdruck besteht, eignen sich diese sehr gut für Lernende in beginnenden Sprachniveaus (Schenker, 2012a) und potenzielle technische Schwierigkeiten, wie langsame Internetverbindungen oder disfunktionale Hardware, können besser umgangen werden (Murphy, Gazi & Cifuentes, 2009).
Vorangegangene Studien haben den Einsatz einer Kombination von synchroner und asynchroner Kommunikation beleuchtet und herausgefunden, dass die Kombination von beiden das Engagement Lernender maximieren kann (Harris & Wambeam, 1996; Ohlund, Yu, Jannasch-Pennell & Digangi, 2000) und dass beide Formen von CMC von Lernenden aus unterschiedlichen Gründen preferiert werden (Johnson, 2006). Synchrone CMC ist einer mündlichen Kommunikation ähnlicher, da verschiedene Kommunikationsstrategien eingesetzt werden und diskursive Strukturen häufiger zu finden sind (Abrams, 2003; Chun, 1994; Pelletieri, 2000; Smith, 2003). Die Studien zeigen, dass in synchroner Kommunikation mehr Output produziert wird als in asynchroner. Jedoch fördern asynchrone Formen die Entwicklung syntaktischer Komplexität stärker (Abrams, 2003; Sotillo, 2000) und sind für die Lernenden teilweise einfacher in ihrem Zeitplan unterzubringen (Abrams, 2003; Johnson, 2006). Die Kategorien von Synchronität und Asynchronität vermischen sich jedoch mit der Weiterentwicklung der digitalen Medien zunehmend (Baron, 2008), da beispielsweise Chat-Kommunikation auch asynchron verlaufen kann, wenn die Nutzenden mit einem Account auf einer Plattform wie Facebook oder Skype eingeloggt sind und Nachrichten im Chat hinterlassen, die zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Auch andere Kategorisierungen, wie die Unterscheidung zwischen primär schriftlicher bzw. mündlicher Online-Kommunikation, beispielsweise in E-Mails vs. Skype Voice-Calls (Heim & Ritter, 2013), sind nicht mehr eindeutig, da sich hybride Formen entwickeln, die nicht kategorisierbar sind. Durch die Entwicklung des Social Web und dessen Applikationen sind neue Möglichkeiten für die Nutzung von CMC im Fremdsprachenunterricht entstanden, da Plattformen wie Soziale Netzwerke eine Integration von synchronen und asynchronen Kommunikationsformen darstellen. Dennoch ist es im Kontext des Sprachunterrichts sinnvoll, diese allgemeinen Unterscheidungen in die didaktischen Überlegungen und die methodische Planung von CMC-Projekten einzubeziehen.
1.4 Chancen und Herausforderungen von CMC für den Fremdsprachenunterricht
Wie bereits erwähnt, konzentrieren sich viele der frühen Studien auf einen Vergleich von sprachlichen Entwicklungen und Besonderheiten in elektronischen Diskussionen und vergleichen diese mit dem traditionellen mündlichen Unterrichtsdiskurs. Diese Studien stellen die Steigerung von authentischen Möglichkeiten zur Übung schriftlicher Sprachkompetenzen (DiMatteo, 1990; Kelm, 1996; Kern, 2000; Warschauer, 1997) durch CMC dar. Im Vergleich zum traditionellen Fremdsprachenunterricht erweitert der virtuelle Austausch mittels einer sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen und Muttersprachler_innen außerhalb des Unterrichts die Diskursoptionen sowie die Rolle der Lernenden (Warschauer, 1996b) und gilt als lernerzentrierter Ansatz (Kelm, 1996). Zudem werden authentische Kommunikationsanlässe kreiert (Goertler, 2009), was zu einer verbesserten allgemeinen Sprachkompetenz führen kann (Belz, 2007b; Belz & Kinginger, 2003; Thorne, 2003). Weitere Vorteile von CMC liegen in hoher Lernmotivation (O’Dowd, 2006) und gesteigerter Interaktion (O’Dowd, 2007; Smith 2012; Thorne, 2006), gesteigertem Output (Beauvois, 1992; Chun, 1994; Smith, 2012), Möglichkeiten zur Reflexion von Sprache (O’Dowd, 2006) und gesteigerter Kontaktzeit mit der Zielsprache (O’Dowd, 2007). Untersuchungen zeigen, dass elektronische schriftliche Diskussionen zu einer erhöhten Sprachproduktion und beinahe ausschließlichem Gebrauch der Fremdsprache führen und dass der verwendete Sprachstil komplexer als in vergleichbaren mündlichen Diskussionen ist (Beauvois, 1998; Kern 1995; Warschauer, 1996b). Zudem kann synchrone CMC die Aufmerksamkeit der Lernenden für linguistische und grammatische Formen fördern und ihre Bereitschaft steigern, in der Fremdsprache sprachliche Risiken einzugehen (Smith, 2004, 2012). Auf der Grundlage der Interaktionshypothese argumentiert, bietet synchrone CMC die Möglichkeit der Wahrnehmung von sprachlichen Umformulierungen ( recasts ), von Bedeutungsaushandlungen und korrektivem Feedback (Salaberry, 2000; Smith, 2004, 2012). Verschiedene Studien, die Eye-Tracking Technologien nutzten, konnten zeigen, dass Lernende ungefähr 60 % der Umformulierungen in synchroner CMC bewusst wahrnehmen und lexikalische Umformulierungen einfacher wahrzunehmen, aufzunehmen und anschließend in schriftlichen Tests wiederzugeben sind als grammatische (Smith, 2010). Des Weiteren zeigen diese Untersuchungen, dass Lernende Umformulierungen aus unterschiedlichen linguistischen Kategorien zwar gleichermaßen ausgesetzt sind, das bedeutet, in der synchronen Kommunikation kommen sie zwar genauso häufig vor, aber semantische und syntaktische Aspekte werden eher wahrgenommen als morphologische (Smith, 2012). Diese Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Umformulierungen bieten Chancen für ein authentisches Lernen der Fremdsprache.
Читать дальше