Nach der kurzlebigen Volksrepublik Krim (und noch vor der Tripolitanischen Republik,  S. 246) war die Demokratische Republik Aserbaidschan das erste selbstständige demokratische muslimische Staatswesen der Nachkriegsordnung im Vorderen Orient. Das erste Parlament wurde am 5. Dezember 1918 eröffnet: Es umfasste 120 Sitze, ethnisch aufgeteilt in 80 Aseri, 21 Armenier, 10 Russen, je einen für Juden, Deutsche, Polen und Georgier sowie fünf an die allgemeinen Gewerkschaften sowie die Gewerkschaft der im Ölsektor Beschäftigten. Die stärkste Fraktion stellte die Müsavat-Partei. Mit Blick auf die Zukunft des Staates spannte sich das Spektrum der Programme der anderen Parteien von vollständiger Unabhängigkeit bis zum Verbleib in Russland. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan der erste mehrheitlich muslimische Staat, in dem Frauen und Männer über gleiche Rechte verfügten. Unter der Führung der politischen Protagonisten, deren einige vorstehend genannt worden sind, begann der Aufbau staatlicher Strukturen, der Verwaltung und einer nationalen Armee. Die neu gegründete Universität Baku wurde die erste moderne Universität des Landes.
S. 246) war die Demokratische Republik Aserbaidschan das erste selbstständige demokratische muslimische Staatswesen der Nachkriegsordnung im Vorderen Orient. Das erste Parlament wurde am 5. Dezember 1918 eröffnet: Es umfasste 120 Sitze, ethnisch aufgeteilt in 80 Aseri, 21 Armenier, 10 Russen, je einen für Juden, Deutsche, Polen und Georgier sowie fünf an die allgemeinen Gewerkschaften sowie die Gewerkschaft der im Ölsektor Beschäftigten. Die stärkste Fraktion stellte die Müsavat-Partei. Mit Blick auf die Zukunft des Staates spannte sich das Spektrum der Programme der anderen Parteien von vollständiger Unabhängigkeit bis zum Verbleib in Russland. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan der erste mehrheitlich muslimische Staat, in dem Frauen und Männer über gleiche Rechte verfügten. Unter der Führung der politischen Protagonisten, deren einige vorstehend genannt worden sind, begann der Aufbau staatlicher Strukturen, der Verwaltung und einer nationalen Armee. Die neu gegründete Universität Baku wurde die erste moderne Universität des Landes.
Die Tatsache, dass zwischen dem Anfang und dem Ende der Aserbaidschanischen Republik fünf Kabinette die Regierung bildeten, lässt freilich ihre innere Fragilität erkennen. Tatsächlich vollzog sich der Aufbau des Staates unter schwierigen Rahmenbedingungen. Erste Hauptstadt war Gändschä, da Baku noch immer von einer revolutionären Kommune regiert wurde, die sich bereits im November 1917 an die Macht gebracht hatte. Dort war es Ende März 1918 zu den erwähnten schweren Massakern an Muslimen gekommen. Erst nach der Befreiung Bakus durch die »Islamische Armee« Enver Paschas (die wiederum mit Massakern an Tausenden von Armeniern verbunden war) im September zog die Regierung nach Baku um. Die Wirtschaft des jungen Staates lag darnieder; namentlich auf dem Lande war die Lage dramatisch. Um die Rote Armee zu schwächen, behinderte England den Export aserbaidschanischen Öls, was die finanziellen Probleme der Regierung verschärfte. Territoriale Dispute mit den gleichfalls jungen Staaten Georgien und Armenien schwächten die Regierung. Während mit Georgien ein vertraglicher Ausgleich zustande kam, eskalierte der Konflikt mit Armenien. Hartnäckig forderte die Regierung in Jerewan die Abtretung weiterer aserbaidschanischer Gebiete. Um Blutvergießen zwischen Aserbaidschanern und Armeniern im Lande selbst zu verhindern und lokale Unruhen niederzuschlagen, rückten am 7. November noch einmal britische Soldaten in Baku ein. Wenige Tage zuvor, am 30. Oktober 1918, war das Osmanische Reich mit dem Waffenstillstand von Mudros aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden und hatte seine Truppen auch aus dem Kaukasus zurückgezogen.
Im August 1919 verließen die britischen Truppen nunmehr definitiv das Land. Damit verschärften sich die inneren und äußeren Konflikte. Die Konzentration auf den Konflikt mit Armenien und das Ausbleiben staatlicher Einnahmen hatte schwere innenpolitische Auswirkungen. Außerstande die soziale und wirtschaftliche Not zu lindern, musste sie die Agitation radikaler prosowjetischer Gruppen hinnehmen, die das Land zu destabilisieren suchten – mit dem Ziel, es auf die Machtübernahme russisch-sowjetischer Truppen vorzubereiten. Noch freilich war die Rote Armee durch die letzte Phase des Bürgerkrieges gegen die Weiße Bewegung gebunden. So begnügten sich prosowjetische Aktivisten zunächst damit, soziale Unruhen anzuheizen. Die endgültige Niederlage der Weißen gegen die Rote Armee zu Beginn 1920 veränderte die Ausgangslage: Jetzt wurden militärische Kräfte frei, die sich daranmachen konnten, den Südkaukasus – beginnend bei Aserbaidschan – zurückzuerobern. Offenkundig hatte sich Lenins Erwartung, die nicht-russischen Völker des ehemaligen Zarenreichs würden sich auf der Grundlage einer eigenständig erlangten sozialistischen Ordnung dem Mutterland der Revolution anschließen, nicht erfüllt. Auch war das Interesse der sowjetischen Führung an der Ölversorgung aus Baku bestimmend. Anfang 1920 entstand in Aserbaidschan eine Kommunistische Partei (AKP).
Die internationale Gemeinschaft, d. h. auch die in Paris versammelten Staatsoberhäupter, hatte bis dahin dem Kaukasus geringe Aufmerksamkeit entgegengebracht. Woodrow Wilson hatte eine aserbaidschanische Delegation bereits im April 1918 – wenn auch ohne großes Interesse und erkennbare Nachwirkungen – empfangen. Angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen aber versammelten sich am 11. Januar 1920 die Staatsoberhäupter und die Außenminister der führenden Siegermächte (Frankreich, England und Italien) sowie die Botschafter der USA und Japans, um die Lage in den Kolonien des zerfallenen Zarenreichs in Asien – darunter Aserbaidschan – zu beraten. Im Ergebnis entschieden sie, Georgien und Aserbaidschan als faktisch bestehende Staaten im Kaukasus anzuerkennen. Diese De-facto-Anerkennung sollte vor allem die Position dieser Länder gegenüber Sowjetrussland auf dem diplomatischen Parkett gewissermaßen immun machen und zum Widerstand gegen eine Invasion vonseiten Sowjetrusslands in den Kaukasus ermuntern.
Diese Entscheidung sollte die Führung in Moskau nicht beeindrucken. Am 21. April 1920 – Aserbaidschan befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krieg mit Armenien um Karabach – wurde von der Heeresleitung der Bolschewiki im Kaukasus die Operation zur Einnahme von Baku gebilligt. Drei Tage später wurden auf Befehl des Zentralkomitees der AKP all ihre Mitglieder und der gesamte Parteiapparat in den militärischen Notstand versetzt. Sie organisierten sich in kleinen bewaffneten Gruppen, die in der Nacht vom 26. auf den 27. April die aserbaidschanisch-russische Grenze bei Dagestan überquerten und sich auf Baku zubewegten. Ein Vorläufiges Komitee für die Revolution stellte der Regierung ein Ultimatum: Darin wurden die Übergabe der Regierung und die Anerkennung der Sowjetmacht gefordert. Die Regierung sah sich zu schwach, Widerstand zu leisten; deshalb akzeptierte sie das Ultimatum und löste sich auf. Das Revolutionäre Komitee Aserbaidschans übernahm die Macht in Baku. Mitte Mai wurde das gesamte Territorium der »Volksrepublik Aserbaidschan« – mit Ausnahme der Territorien an der armenischen Grenze (wegen des noch andauernden Krieges) – sowjetisiert.
Ermutigt durch den Vertrag von Sèvres (  S. 157), in dem der Republik Armenien große Teile Ostanatoliens zugesprochen wurden (die in Brest-Litowsk an das Osmanische Reich gefallen waren), machten sich armenische Truppen daran, diese Gebiete militärisch zu besetzen. Nach anfänglichen Erfolgen erlitten sie eine vernichtende Niederlage. Im Vertrag von Alexandropol (heute Gümrü) am 2. Dezember musste Armenien auf seine Ansprüche verzichten. Zu einer Ratifizierung des Vertrages durch das armenische Parlament sollte es nicht mehr kommen, denn bereits am 6. Dezember riefen armenische Bolschewiken die Armenische Sozialistische Sowjetrepublik aus. Damit aber war nicht mehr die Regierung eines unabhängigen demokratischen armenischen Staates, sondern eine von Moskau abhängige Regierung in Jerewan der künftige Verhandlungspartner in Sachen der Grenzziehung zwischen der im Entstehen begriffenen neuen Türkei und den südkaukasischen Gebieten des ehemaligen Zarenreichs. Am 11. Februar 1921 schließlich marschierten Verbände einer »Arbeiter- und Bauernarmee« in Georgien ein und nahmen am 25. Februar die Hauptstadt Tiflis ein; noch am selben Tag wurde die Georgische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen.
S. 157), in dem der Republik Armenien große Teile Ostanatoliens zugesprochen wurden (die in Brest-Litowsk an das Osmanische Reich gefallen waren), machten sich armenische Truppen daran, diese Gebiete militärisch zu besetzen. Nach anfänglichen Erfolgen erlitten sie eine vernichtende Niederlage. Im Vertrag von Alexandropol (heute Gümrü) am 2. Dezember musste Armenien auf seine Ansprüche verzichten. Zu einer Ratifizierung des Vertrages durch das armenische Parlament sollte es nicht mehr kommen, denn bereits am 6. Dezember riefen armenische Bolschewiken die Armenische Sozialistische Sowjetrepublik aus. Damit aber war nicht mehr die Regierung eines unabhängigen demokratischen armenischen Staates, sondern eine von Moskau abhängige Regierung in Jerewan der künftige Verhandlungspartner in Sachen der Grenzziehung zwischen der im Entstehen begriffenen neuen Türkei und den südkaukasischen Gebieten des ehemaligen Zarenreichs. Am 11. Februar 1921 schließlich marschierten Verbände einer »Arbeiter- und Bauernarmee« in Georgien ein und nahmen am 25. Februar die Hauptstadt Tiflis ein; noch am selben Tag wurde die Georgische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen.
So waren staatliche Gebilde entstanden, die zwar formal zunächst noch als unabhängige Staaten fortbestanden, faktisch aber den Richtlinien aus Moskau unterworfen waren; dort wurden auch die das Schicksal ihrer Länder betreffenden Verträge abgesegnet. Seit dem 12. März 1922 bildeten die drei Republiken gemeinsam die Transkaukasische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik. Mit der Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) am 30. Dezember 1922 wurde diese Teil eines neuen, russisch dominierten Vielvölkerstaates mit einer föderalen Unionsverfassung. Faktisch verloren Georgien, Armenien und Aserbaidschan jedoch endgültig ihre Unabhängigkeit. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 sollte das Großreich, das als zaristisches 1917/18 untergegangen und in der Folge als sowjetisches wieder auferstanden war, für immer von der Landkarte verschwunden sein. Neue Staaten entstanden; im Kaukasus konnten ihre Gründer auf die kurze staatliche Tradition der Jahre zwischen 1918 und 1921 zurückblicken. Zum Unglück der Völker aber sollten die alten Konflikte – verschärft durch in der Sowjetzeit getroffene weitere Maßnahmen und Entscheidungen – wiederaufleben.
Читать дальше
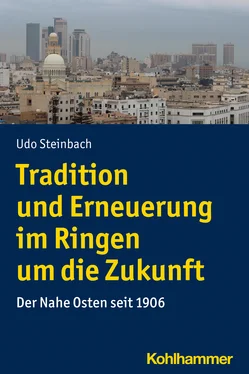
 S. 246) war die Demokratische Republik Aserbaidschan das erste selbstständige demokratische muslimische Staatswesen der Nachkriegsordnung im Vorderen Orient. Das erste Parlament wurde am 5. Dezember 1918 eröffnet: Es umfasste 120 Sitze, ethnisch aufgeteilt in 80 Aseri, 21 Armenier, 10 Russen, je einen für Juden, Deutsche, Polen und Georgier sowie fünf an die allgemeinen Gewerkschaften sowie die Gewerkschaft der im Ölsektor Beschäftigten. Die stärkste Fraktion stellte die Müsavat-Partei. Mit Blick auf die Zukunft des Staates spannte sich das Spektrum der Programme der anderen Parteien von vollständiger Unabhängigkeit bis zum Verbleib in Russland. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan der erste mehrheitlich muslimische Staat, in dem Frauen und Männer über gleiche Rechte verfügten. Unter der Führung der politischen Protagonisten, deren einige vorstehend genannt worden sind, begann der Aufbau staatlicher Strukturen, der Verwaltung und einer nationalen Armee. Die neu gegründete Universität Baku wurde die erste moderne Universität des Landes.
S. 246) war die Demokratische Republik Aserbaidschan das erste selbstständige demokratische muslimische Staatswesen der Nachkriegsordnung im Vorderen Orient. Das erste Parlament wurde am 5. Dezember 1918 eröffnet: Es umfasste 120 Sitze, ethnisch aufgeteilt in 80 Aseri, 21 Armenier, 10 Russen, je einen für Juden, Deutsche, Polen und Georgier sowie fünf an die allgemeinen Gewerkschaften sowie die Gewerkschaft der im Ölsektor Beschäftigten. Die stärkste Fraktion stellte die Müsavat-Partei. Mit Blick auf die Zukunft des Staates spannte sich das Spektrum der Programme der anderen Parteien von vollständiger Unabhängigkeit bis zum Verbleib in Russland. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan der erste mehrheitlich muslimische Staat, in dem Frauen und Männer über gleiche Rechte verfügten. Unter der Führung der politischen Protagonisten, deren einige vorstehend genannt worden sind, begann der Aufbau staatlicher Strukturen, der Verwaltung und einer nationalen Armee. Die neu gegründete Universität Baku wurde die erste moderne Universität des Landes.










