Die Geschichte des Weges, den die kaukasischen Völker und Gesellschaften von 1801 bis 1917 gegangen sind, kann im Rahmen unserer Darstellung nur in signifikanten Schlaglichtern erzählt werden. Unübersehbar aber verbindet sie sich an vielen Punkten mit den Entwicklungen im Vorderen Orient im 19. und 20. Jahrhundert, die Gegenstand des Buches sind. Erinnert sei an die armenische Frage und an die Auswirkungen der geistigen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Zarenreich auf die Modernisierungsbestrebungen der Eliten im Osmanischen Reich und im Staat der iranischen Qadscharen – den muslimischen Aserbaidschanern im russisch beherrschten Südkaukasus kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu. Erinnert sei weiter an die religiösen Modernisierungsbestrebungen unter den Muslimen im Zarenreich (Dschadidismus), die insbesondere auf die Muslime des Osmanischen Reichs weitergewirkt haben, und schließlich an die panturkischen Bestrebungen, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs in der osmanischen Kriegsführung erkennbar waren und in deren Strategie Aserbaidschan ein hoher Stellenwert zukam. Erinnert sei aber auch daran, dass die Erdölwirtschaft auf der Baku benachbarten Halbinsel Abscheron seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts weltwirtschaftliche Dimensionen anzunehmen begann. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs wurden 80 % der Erdölproduktion des Zarenreichs und 15 % der Welterdölproduktion hier gefördert. Erdölbarone aus vieler Herren Länder rivalisierten um fabelhaften Reichtum, zugleich waren die Ölarbeiter empfänglich für sozialpolitische Mobilisierung – seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts seitens der radikalen Linken. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs richteten sich internationale Begehrlichkeiten, namentlich des postrevolutionären Russlands, Englands und Deutschlands auf die Ölressourcen Aserbaidschans.
Mit den russischen Eroberungen im südlichen Kaukasus vollzog sich dort eine erhebliche Bevölkerungsverschiebung, die besonders von einem starken Zuwachs des armenischen Bevölkerungsanteils gekennzeichnet war. Die christlichen Armenier mit ihren einflussreichen Gemeinden im gesamten Nahen Osten, auf dem Balkan, in Westeuropa und Russland verfügten über Bildungstraditionen, Handwerkerzünfte und ein fast weltweit agierendes Netzwerk von Kaufleuten. Armenische Handwerker und Händler waren von dem georgischen König Irakli II. (reg. 1762–1798) angeworben worden. Katharina II. hatte 1768 dem Katholikos von Etschmiadzin, dem Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche, Schutzbriefe für reisende Kaufleute ausgestellt, die ein Bindeglied zwischen den nahöstlichen, südkaukasischen und zentralasiatischen armenischen Gemeinden darstellten. Mit den beiden russisch-persischen Kriegen stieg der armenische Anteil an der Bevölkerung in den Gebieten nördlich des Aras an. Fast 50 000 Armenier machten zwischen 1828 und 1830 von den besonderen Einwanderungsrechten für Christen Gebrauch. Nach dem Ende des russisch-türkischen Krieges 1828/29 erhielt auch die christlich-armenische Bevölkerung der russisch besetzten Gebiete des Osmanischen Reichs diese Privilegien: Etwa 90 000 Menschen aus Ebenen von Erzurum und Agrı begleiteten die russische Armee auf ihrem Rückzug aus Ostanatolien. Umgekehrt verließen zahlreiche muslimische Familien die Gebiete nördlich des Aras in Richtung Persien und Osmanisches Reich. Weitere Einwanderungswellen folgten später: als Ergebnis des russisch-türkischen Krieges 1877–1879, antiarmenischer Pogrome im Osmanischen Reich ab 1890 und des Genozids von 1915. Lebten 1846 in Südkaukasien ungefähr 200 000 Armenier, so waren es 1915 etwa 1 680 000. 25Zugleich dehnte sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Landbesitz der Armenier weiter aus, die ebenfalls einen relativ hohen Anteil an den städtischen Bildungsschichten stellten.
Die Ansiedlung christlicher Armenier hatte nicht zuletzt das Ziel, ein ethnisches Gegengewicht zu der muslimischen Bevölkerung zu schaffen. Das trug zu einer anhaltenden Verschärfung konfessioneller Spannungen bei, machte aber die Armenier über Jahrzehnte zu loyalen Untertanen des Zaren und seiner Regierung. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte eine armenische Mittelschicht vor allem wohlhabender Kaufleute Zugang zu Verwaltung und Armee gefunden. Zugleich aber befeuerte nicht zuletzt die von Ausgrenzung, Verfolgung und seit den 1890er Jahren von Pogromen gekennzeichnete schwierige Lage der Armenier im benachbarten Osmanischen Reich ein nationales Erwachen und ließ im Russischen Reich eine armenische Nationalbewegung entstehen. Sie strebte nicht nur nach größerer Eigenständigkeit innerhalb des Zarenreichs, sondern wandte sich im Streben nach einem starken, verteidigungsfähigen Nationalstaat auch gegen die Nachbarvölker wie die »Türken« Aserbaidschans, mit denen die Armenier teils territorial überschneidend siedelten. Im Übergang zu der kurzlebigen Staatlichkeit nach der bolschewistischen Oktoberrevolution war die 1890 in Tiflis gegründete armenische nationalistische Partei Allianz der Revolutionäre (Daschnakzutyun) eine bestimmende Kraft. Über deren Rolle im Zusammenhang mit dem Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915/16 ist oben bereits gesprochen worden (  S. 114). Insgesamt also waren über der Zukunft der Beziehungen zwischen »Türken« (Aserbaidschanern) und Armeniern dunkle Wolken aufgezogen, als sich die Kaukasusvölker Ende 1917 in Gestalt der Transkaukasischen Föderation auf den Weg der Unabhängigkeit begaben.
S. 114). Insgesamt also waren über der Zukunft der Beziehungen zwischen »Türken« (Aserbaidschanern) und Armeniern dunkle Wolken aufgezogen, als sich die Kaukasusvölker Ende 1917 in Gestalt der Transkaukasischen Föderation auf den Weg der Unabhängigkeit begaben.
Während die Armenier als ethnisch-religiöse Gemeinschaft ohne eigenständige staatliche Struktur über das gesamte Gebiet des Südkaukasus verbreitet siedelten, wies Georgien durch die Geschichte erhärtete staatliche Konturen auf. Die Annexion vonseiten Russlands 1801 vereinigte dauerhaft die verschiedenen Regionen des Landes, die in der Geschichte teilweise ein Eigenleben geführt hatten. Dieser Umstand sollte im Lauf des 19. Jahrhunderts den nationalen Gedanken unter der georgischen Elite beflügeln. Zunächst freilich artikulierte sich Widerstand gegen die russische Macht. Die eigenständige (»autokephale«) Orthodoxe und Apostolische Kirche von Georgien geriet unter die Aufsicht der Russisch-Orthodoxen Kirche; der Kleinadel, seit jeher die Stütze des Staates und der Armee, sah sich in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht. Erst nach Jahrzehnten der Aufstände und des Widerstands begannen sich die Institutionen des zaristischen Staates und die gesellschaftlichen Traditionen der Georgier miteinander zu versöhnen. Sowohl die adligen Familien als auch wohlhabende Bürger schickten ihre Söhne auf die russischen, später auch deutschen und französischen Universitäten. Von dort brachten sie liberale Ideen nach Hause, die sie mit der Forderung nach der »Wiedergeburt der Heimat« verknüpften. Unter dem Banner: »Heimat, Sprache und Glaube«, suchten sie das nationale Selbstbewusstsein zu wecken und riefen zu einer Wiedergeburt der georgischen Kultur und zum Kampf gegen das Analphabetentum auf. Später traten Forderungen nach einer Modernisierung der Wirtschaft, namentlich der Landwirtschaft, hinzu. Für eine radikale soziale Umwälzung, für die der 1878 im georgischen Gori geborene Iosseb Bessarionisdse (Josef Wissarionowitsch) Dschughaschwili, der 1912 den Namen Stalin annahm, kämpfte, gab es in Georgien keinen Nährboden. Innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands gehörten die georgischen Vertreter mehrheitlich dem Flügel der sozialdemokratischen Menschewiki an. Als die revolutionären Bolschewiki unter der Führung Lenins im November 1917 die Macht übernahmen, entschied die politische Führung in Tiflis, den russischen Staatsverband zu verlassen.
Im Untertitel ihres magistralen Werkes Muslim – Untertan – Bürger über gesellschaftliche Transformationsprozesse spricht Eva-Maria Auch eben nicht von »Aserbaidschan« als dem Gegenstand der Analyse, sondern von den »muslimischen Ostprovinzen Südkaukasiens«. Damit deutet sie das Fehlen einer festen übergreifenden staatlichen Struktur »der Aserbaidschaner« zum Zeitpunkt der russischen Eroberung und danach an. Die aserbaidschanische Ethnie lag damit etwa zwischen der georgischen und der armenischen: Wie vorstehend festgestellt, verfügten die Georgier des beginnenden 19. Jahrhunderts über eine lange und bis in die Gegenwart kontinuierliche staatliche Tradition, während die Armenier als an zahlreichen Plätzen verstreute Volksgemeinschaft ohne eine gefestigte politische Struktur siedelten. Mit der Eroberung turksprachiger – »aserbaidschanischer« – Gebiete im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde nach den armenischen und georgischen Christen eine islamisch geprägte Bevölkerung des südlichen Kaukasus Teil des Russischen Reichs. Im Unterschied zu Georgiern und Armeniern, die sich durch die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte hindurch als religiöse und kulturelle Inseln in einem Meer der Muslime behauptet hatten, waren die lokalen aserbaidschanischen Herrschaften Teile großräumiger islamischer Staatenbildungen gewesen, die sich ihrerseits wiederum der islamischen Gemeinschaft (umma) verbunden sahen. Aus dem aserbaidschanischen Ardabil stammte die turksprachige Dynastie der Safawiden, die seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts das iranische Hochland und das Gebiet des südlichen Kaukasus beherrscht hatte. Auf die Schiitisierung des safawidischen Staates (einschließlich Aserbaidschans) ist bereits hingewiesen worden (  S. 24).
S. 24).
Читать дальше
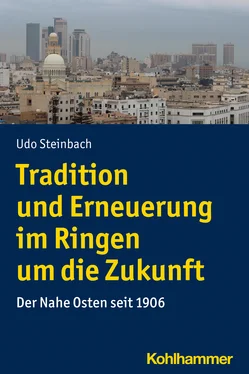
 S. 114). Insgesamt also waren über der Zukunft der Beziehungen zwischen »Türken« (Aserbaidschanern) und Armeniern dunkle Wolken aufgezogen, als sich die Kaukasusvölker Ende 1917 in Gestalt der Transkaukasischen Föderation auf den Weg der Unabhängigkeit begaben.
S. 114). Insgesamt also waren über der Zukunft der Beziehungen zwischen »Türken« (Aserbaidschanern) und Armeniern dunkle Wolken aufgezogen, als sich die Kaukasusvölker Ende 1917 in Gestalt der Transkaukasischen Föderation auf den Weg der Unabhängigkeit begaben.










