Gleichwohl weisen sie in die Zukunft. Es zeichnet sich ab, dass die Welt des alten Vorderen Orients im Untergang befindlich ist. Das gilt für die Herrscher und Dynastien, die Konzepte und Konstrukte, mit denen sie ihre Herrschaft gerechtfertigt haben, die Eliten, auf die sie ihre Herrschaft gestützt haben, die gesellschaftlichen Strukturen und Schichtungen derer, die ihre Untertanen waren, und auch für die Kultur, die, stark religiös unterfüttert, den Zusammenhalt von Herrscher und Beherrschten sicherstellte. Ein neuer Weg tut sich auf, andere Wegmarken sind erkennbar. Sie weisen nicht nur auf veränderte innere Ordnungen: Das Ende des osmanischen Vielvölkerstaats, dessen Zerfall sich unter den europäischen Untertanen des Sultans/Kalifen bereits seit einhundert Jahren vollzog, würde auch im Vorderen Orient eine neue politische Landkarte entstehen lassen. Und schließlich war in den Umbrüchen zugleich auch ein Streben nach Emanzipation aus überkommenen äußeren Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen offenkundig. Vor diesem Hintergrund würde es nach Lage der Dinge ein langer Weg sein – und auch kein gerader Weg, sondern eine Strecke voller Umwege. Am Ende des 20. Jahrhunderts werden neue Revolutionen, Revolten, Staatsstreiche und Gewaltakte stehen, die Verheißungen, die zu seinem Beginn gegeben zu sein schienen, endlich einzulösen.
5.4 Der kurze Frühling im Kaukasus
Das Ende des Ersten Weltkriegs war mit einem umfassenden und tiefgreifenden Zusammenbruch gleich mehrerer politischer Ordnungen in Europa und Asien verbunden. Drei multiethnische und multireligiöse Großreiche wurden erfasst: Das Habsburgische Kaiserreich, das Reich des osmanischen Sultans/Kalifen und das Zarenreich der Romanow. Bei dem vierten in diesem Zusammenhang, dem Deutschen Reich, handelte es sich im Unterschied zu den Genannten um ein national, religiös und kulturell relativ homogenes Staatswesen. Mit dem Zusammenbruch der drei Erstgenannten waren zwangsläufig Staatenbildungsprozesse verbunden, die Teile dreier Kontinente erfassten. Die Folgen des Zusammenbruchs des Deutschen Reichs blieben auf Mitteleuropa beschränkt.
Im März 1917 dankte Zar Nikolaus II. ab; damit kam die jahrhundertlange Herrschaft der Romanow an ihr Ende. Nach der von Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) angeführten bolschewistischen »Oktoberrevolution« schloss die neue Führung Anfang Dezember 1917 einen Waffenstillstand mit den Mittelmächten und trat damit de facto aus dem Krieg aus. Zugleich veröffentlichte sie die Geheimverträge, welche die zaristische Regierung mit den Regierungen der Entente-Mächte die Zukunft der Kriegsgegner betreffend geschlossen hatte.
Bereits am 7. Dezember 1917 veröffentlichte das neue Regime eine von Lenin und Josef Wissarionowitsch Stalin (1878–1953) unterzeichnete »Botschaft an alle werktätigen Muslime in Russland und des Orients«. Sie sollte zeigen, dass die neue Führung im Unterschied zur zaristischen Regierung den unmittelbaren Zusammenhang von nationaler und religiöser Frage erkannt hatte und bereit war, ihm politische Rechnung zu tragen. »Fortan werden Euer Glaube und Eure Bräuche, Eure nationalen und kulturellen Institutionen als frei und nicht verletzlich erklärt«, hieß es darin. »Baut Euer nationales Leben frei und unbehindert auf. Das ist Euer Recht«. 24Darin lag das Zugeständnis eines eigenen Weges der »Völker des Orients« zu einer sozialistischen Ordnung auf der Grundlage ihrer jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Traditionen.
Ihre Botschaft rasch öffentlich zu machen, hatten die beiden bolschewistischen Führer neben dem inhaltlichen Programm auch einen politisch-strategischen Grund: Denn die politischen Führungen im südlichen Kaukasus waren nicht bereit, den undemokratischen bolschewistischen Coup einfach hinzunehmen. Vielmehr sahen sie damit den Zeitpunkt gekommen, eigene Wege zu gehen, die zu Autonomie, am Ende gar zum Austritt aus dem russischen Imperium und zu Unabhängigkeit und eigenstaatlicher Existenz führen würden. Bereits am 24. November wurde in Tiflis das Transkaukasische Kommissariat ausgerufen, das die Funktion einer provisorischen Regierung ausüben sollte. Es bestand aus georgischen Sozialdemokraten (Menschewiki), der armenischen Daschnaktzutyun- und der aserbaidschanischen Müsavat-Partei. Aus ihm ging am 23. Januar 1918 ein regionales Parlament, der Sejm, hervor. Am 22. April erklärte er die Unabhängigkeit Transkaukasiens und die Gründung der Transkaukasischen Republik mit der Hauptstadt Tiflis (Tbilisi). Amtssprachen waren Georgisch, Armenisch und Aserbaidschanisch.
Zu diesem Zeitpunkt aber waren bereits tiefe Verwerfungen zwischen den beteiligten Parteien aufgebrochen, die sowohl ordnungs- und gesellschaftspolitische als auch ethnische Triebkräfte erkennen ließen. Die Spannungen reichten von Divergenzen über das Verhältnis zum Osmanischen Reich (dessen Führung in der Transkaukasischen Republik in erster Linie einen Puffer zu Russland sah) und zu Deutschland (das ein wachsendes Interesse an den Ölvorkommen der Region nahm) bis zu Konflikten über die Zukunft der politischen und gesellschaftlichen Systeme im Südkaukasus. Ende März hatte eine Allianz von Bolschewiken und vornehmlich armenischen Daschnaken in Baku ein Massaker verübt, dem etwa 10 000 muslimische Aserbaidschaner zum Opfer gefallen waren. Als am 26. Mai 1918 3000 deutsche Soldaten im georgischen Hafen Poti landeten – gemäß einer Vereinbarung mit den Georgiern, diese gegen territoriale Ansprüche der osmanischen Regierung zu verteidigen, war das Schicksal der Transkaukasischen Republik besiegelt. Noch am selben Tag folgte die Unabhängigkeitserklärung Georgiens und die georgische Delegation verließ den Sitzungssaal des Sejm. Ihr folgten am 28. Mai die aserbaidschanische und die armenische Delegation. Der Sejm war aufgelöst; auf transkaukasischem Boden entstanden drei unabhängige Republiken.
Damit war eine in geschichtlicher Perspektive neuartige Lage entstanden. Die Armenier sind zwar ein uraltes kaukasisches Volk mit einer epochenweise starken staatlichen, ja imperialen Tradition; ein eigenstaatliches Armenien aber hatte es seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr gegeben. Die turksprachigen Völker, aus denen auch das aserbaidschanische Volk hervorging, waren erst im 11. Jahrhundert in den vorderorientalischen Raum Anatoliens und des iranischen Hochlands eingedrungen und hatten dort ihre eigene Staatlichkeit errichtet. Zwar war auch die Dynastie der Safawiden, die mit Schah Isma’il 1501 an die Macht kam, türkisch-aserbaidschanischen Ursprungs (der Sufi-Orden, dem sie entstammte, hatte in Ardabil seinen Sitz). Der safawidische Iran aber, dem mit der Verbreitung des schiitischen Islams eine eigene Identität verordnet wurde, verstand sich als persischer – nicht aber als aserbaidschanischer – Staat (  S. 24). Als er im 18. Jahrhundert zerfiel, entstanden auf seinem Boden eine Vielzahl von lokalen türkisch-muslimischen »Khanaten«, deren Mehrheit – zum Teil mit starken armenischen Bevölkerungsanteilen – in den ersten Jahrzehnten von Russland vereinnahmt wurde. Lediglich Georgien hat – wenn auch in unterschiedlicher Ausdehnung und immer wieder von fremden Mächten bedroht und/oder beherrscht – bis zu seiner Eingliederung in Russland 1801 ein starkes eigenstaatliches – gleichsam »nationales« – Profil.
S. 24). Als er im 18. Jahrhundert zerfiel, entstanden auf seinem Boden eine Vielzahl von lokalen türkisch-muslimischen »Khanaten«, deren Mehrheit – zum Teil mit starken armenischen Bevölkerungsanteilen – in den ersten Jahrzehnten von Russland vereinnahmt wurde. Lediglich Georgien hat – wenn auch in unterschiedlicher Ausdehnung und immer wieder von fremden Mächten bedroht und/oder beherrscht – bis zu seiner Eingliederung in Russland 1801 ein starkes eigenstaatliches – gleichsam »nationales« – Profil.
Vor diesem Hintergrund war mit der Gründung der drei südkaukasischen Republiken 1918 eine neue Lage entstanden. Die Fäden sehr unterschiedlicher geschichtlicher Entwicklungen sowie kultureller und religiöser Gegebenheiten waren zu nationalstaatlichen Gebilden verwoben. Die Herausforderung an die herrschenden Eliten war eine doppelte: ihre Herrschaft nach innen zu konsolidieren – das bedeutete, durch die Zustimmung sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher, ethnischer und religiöser Gruppen zur Ausübung der Macht innerhalb der neuen Grenze legitimiert zu werden – und nach außen sich zugleich der machtpolitischen und territorialen Gelüste jener Mächte zu erwehren, die durch die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte hindurch um die Vorherrschaft im südlichen Kaukasus gerungen hatten. Angesichts der Schwäche Irans und der Auflösung des Osmanischen Reichs hatte die Führung in Moskau am Ende die besseren Karten. Nach der Revolution noch selbst in einem Zustand der Schwäche agierend, sollte es ihr unter dem Bruch von Versprechungen der ersten Stunde insbesondere Lenins gelingen, die sozialpolitischen Verwerfungen, die von bolschewistischen Parteigängern ausgenutzt und zugespitzt wurden, mit den machpolitischen Zielen Moskaus in Übereinstimmung zu bringen. Deshalb war den jungen Staaten im Kaukasus wie anderen, insbesondere muslimischen Regionen in Zentralasien nur kurze Lebensdauer beschieden. Erst mit dem definitiven Ende des sozialistischen Nachfolgestaates des Zarenreichs sollten die Rahmenbedingungen für eine dauerhafte Neuordnung der politischen Landkarte im südlichen Kaukasus und in Zentralasien entstehen.
Читать дальше
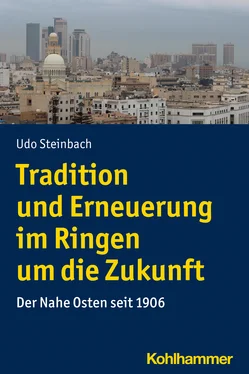
 S. 24). Als er im 18. Jahrhundert zerfiel, entstanden auf seinem Boden eine Vielzahl von lokalen türkisch-muslimischen »Khanaten«, deren Mehrheit – zum Teil mit starken armenischen Bevölkerungsanteilen – in den ersten Jahrzehnten von Russland vereinnahmt wurde. Lediglich Georgien hat – wenn auch in unterschiedlicher Ausdehnung und immer wieder von fremden Mächten bedroht und/oder beherrscht – bis zu seiner Eingliederung in Russland 1801 ein starkes eigenstaatliches – gleichsam »nationales« – Profil.
S. 24). Als er im 18. Jahrhundert zerfiel, entstanden auf seinem Boden eine Vielzahl von lokalen türkisch-muslimischen »Khanaten«, deren Mehrheit – zum Teil mit starken armenischen Bevölkerungsanteilen – in den ersten Jahrzehnten von Russland vereinnahmt wurde. Lediglich Georgien hat – wenn auch in unterschiedlicher Ausdehnung und immer wieder von fremden Mächten bedroht und/oder beherrscht – bis zu seiner Eingliederung in Russland 1801 ein starkes eigenstaatliches – gleichsam »nationales« – Profil.










