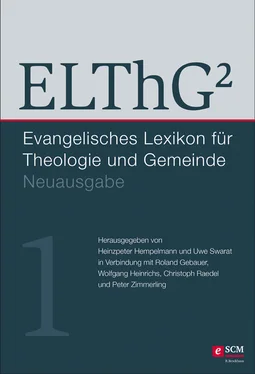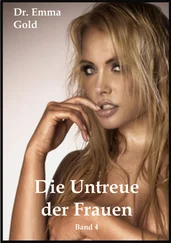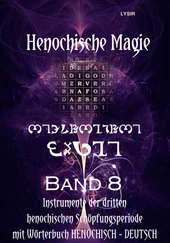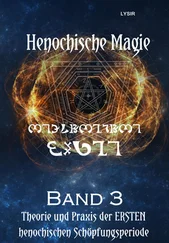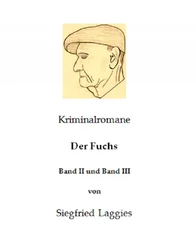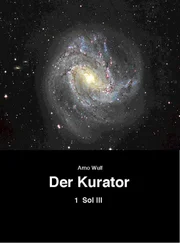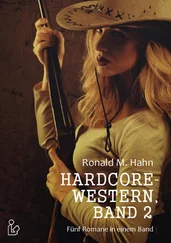Hartmut Zopf, Vorsitzender des Mecklenburgischen Gemeinschaftsverbands e.V.: Boor, Werner de
Rev. Dr. Dean Zweck, Australian Lutheran College, North Adelaide, Australien: Australien
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Abaelard, Peter (1079–1142)
Abendmahl
Abendmahlsgemeinschaft
Aberglaube
Ablass
Abraham(it)ische Religionen
Absolute, Das
Absolutheit des Christentums
Abstinenz
Abtreibung
Adam und Eva
Adelshofen (Kommunität)
Adiaphora
Adoptianer / Adoptianismus
Adoption
Adveniat
Advent
Adventisten / Adventismus
Agende
Agendenstreit
Agnostizismus
Agnus Dei
Agrapha
Agricola, Johann (ca. 1494–1566)
Ägypten
Ahldener Bruderschaft
Ahnenverehrung
Akademie(n), Evangelische
Akkommodation
Aland, Kurt (1915–1994)
Albertus Magnus (ca. 1200–1280)
Albigenser
Albrecht, Jacob (1759–1808)
Albrecht von Mainz (1490–1545)
Alexander von Hales (ca. 1185–1245)
Alexandrinische Theologie
Alkoholismus
Alkuin (ca. 730–804)
Allerheiligen
Allerseelen
Allianz, Evangelische
Allianz, Evangelische in Deutschland (verbundene Werke)
Allianz, Evangelische in Deutschland (Werke und Einrichtungen)
Allmacht Gottes
Allversöhnung (apokatastasis pantōn)
Allwissenheit Gottes
Aloger
Altar
Alte Kirche
Altenhilfe
Alter
Altes Testament – Geschichte der Erforschung
Älteste
Althaus, Paul (1888–1966)
Altkatholiken
Altlutheraner
Ambrosianischer Lobgesang (Te Deum laudamus)
Ambrosius von Mailand (ca. 333–397)
Amen
Amische / Amish
Amsdorf(f), Nikolaus von (1483–1565)
Amt
Amtshandlungen
Amyraut, Moyse (1596–1664)
Analogia entis / analogia fidei
Analogie
Anamnese
Anarchismus
Anbetung
Andacht
Andachtsbild
Andorra
Andreae, Jakob (1528–1590)
Andreae, Johann Valentin (1586–1654)
Anfechtung
Anglikaner / Anglikanismus
Anglikanischer Gottesdienst
Angst
Anhalt(s), Evangelische Landeskirche
Animismus
Anlage, religiöse
Ansbacher Ratschlag
Anselm von Canterbury (1034–1109)
Ansgar (801–865)
Anskar-Kirche
Anthropomorphismus
Anthroposophie
Antichrist
Antijudaismus
Antimodernisteneid
Antinomie
Antinomismus
Antiochenische Theologie
Antiochien
Antiphon
Antisemitismus
Antitrinitarier
Antonius (ca. 251–356)
Äon / Äonenlehre
Apokalyptik
Apokryphen (AT)
Apokryphen (NT)
Apollinaris von Laodicaea (ca. 315–392)
Apologeten, altkirchliche
Apologetik
Apophatische Theologie
Apostasie
Apostel / Apostolat
Apostelamt Jesu Christi
Apostelgeschichte
Apostelkonzil
Apostolikumsstreit
Apostolische Konstitutionen
Apostolische Väter
Apostolisches Glaubensbekenntnis (Apostolikum)
Arabische Halbinsel
Aramäer
Arbeit
Arbeiter / Arbeiterbewegung
Arbeiterkolonie
Arbeiterpriester
Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen (ACL)
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM)
Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation (AGJE)
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD)
Arbeitslosigkeit
Arbeitsrecht, kirchliches
Archäologie, biblische
Archäologie, christliche
Archivwesen
Argentinien
Aristoteles (384–322 v.Chr.)
Aristotelismus
Arius / Arianer
Arkandisziplin
Armenien
Arminius / Arminianismus
Armut
Arndt, Ernst Moritz (1769–1860)
Arndt (Aquila), Johann (1555–1621)
Arnold, Eberhard (1883–1935)
Arnold, Gottfried (1666–1714)
Arnoldshainer Konferenz (AKf)
Arzt
Ärztliche Mission
Aschermittwoch
Askese
Asmussen, Hans (1898–1968)
Assyrische Kirche des Ostens
Ästhetik
Astralreligion
Astrologie
Asyl / Asylrecht
Athanasianum
Athanasius von Alexandrien (ca. 295–373)
Atheismus
Äthiopien
Athos
Auberlen, Carl August (1824–1864)
Auferstehung der Toten
Auferstehung Jesu
Aufklärung
Augsburger Bekenntnis und Apologie
Augsburger Religionsfrieden
Augustin (354–430)
Augustinismus
Ausbildung, theologische
Australien
Auswanderung
Autobahnkirche
Autokephalie
Autonomie
Autorität
Ave Maria
Abaelard, Peter (1079–1142)
Der 1079 in Le Pallet in der Bretagne geb. und am 21.4.1142 bei Chalon-sur-Saône gest. A. gehört zu den herausragenden Philosophen und Theologen des Hochmittelalters. Sein unkonventionelles Denken hat ihn immer wieder in Konflikte mit den herrschenden Autoritäten geführt und zu einem unsteten Dasein gezwungen. Als Sohn eines Ritters verzichtete er auf sein Erbrecht und widmete sein Leben der Wissenschaft. A. studierte in Paris bei Wilhelm von Champeaux um 1100 zunächst Logik und nach einem zwischenzeitlichen Zerwürfnis, währenddessen er in Melun und Corbeil lehrte, ab 1108 Rhetorik. Wieder kam es zum Streit, und A. gründete außerhalb von Paris auf dem Mont St. Geneviève eine eigene Schule. 1113 folgten ein Theologiestudium bei dem berühmtesten Lehrer seiner Zeit, Anselm von Laon, dessen Unterricht ihn auch nicht zufriedenstellte, und eigene Lehrtätigkeit an der Pariser Schule von Notre-Dame. A.s glänzende wiss. Karriere wurde vorerst beendet durch das Liebesverhältnis zu seiner überaus gebildeten Schülerin Heloïse, aus dem ein Sohn hervorging. Das geschah im Hause ihres Onkels, des Kanonikers Fulbert, der A. eines Nachts überfallen und entmannen ließ. Heloïse trat daraufhin in das Kloster Argenteuil bei Paris ein, A. wurde Mönch im Kloster St. Denis.

Vor 1120 nahm A. seine Lehrtätigkeit wieder auf und verfasste mit der » Theologia Summi Boni« (Theologie vom höchsten Guten) sein erstes theol. Werk. Wieder geriet er in Konflikte mit der trad. Linie. Das Werk wurde 1122 auf der Synode von Soissons verurteilt. A. musste es selbst ins Feuer werfen und kam als Ketzer in Klosterhaft. Bald jedoch durfte er nach St. Denis zurückkehren, wo er sich rasch unbeliebt machte. Daraufhin gründete A. in Quincey bei Nogent-sur-Seine ein Bethaus, das er nach dem Zuzug zahlreicher Schüler zum »Kloster zum Parakleten« ausbaute. Seit 1135/36 lehrte er wieder mit großem Erfolg in Paris. Seine nun entstehenden Schriften (» Theologia Scholarium« [Theologie der Gemeinschaft der Lernenden], Römerbriefkommentar, » Ethica« ) gerieten bald ins Visier seiner Gegner.
→ Bernhard von Clairvaux sorgte mit zweifelhaften Methoden dafür, dass A. 1140 ohne Anhörung vom Papst als Häretiker zu ewigem Stillschweigen verurteilt wurde. A. wollte sich vermutlich in Rom verteidigen, nahm aber unterwegs Zuflucht im Kloster Cluny, wo er bis zu seinem Tode lebte. Dem A. wohlgesonnenen Abt Petrus Venerabilis gelang die Aufhebung des Urteils und die Versöhnung von A. und Bernhard. A. starb am 21.4.1142 in dem zu Cluny gehörenden Priorat St. Marcel bei Chalon-sur-Saône, nach den Worten von Abt Petrus ein Vorbild an Demut. Sein Leichnam wurde in das Kloster zum Parakleten überführt, wo auch Heloïse nach ihrem Tod 1164 neben ihm ihr Grab fand.
Читать дальше