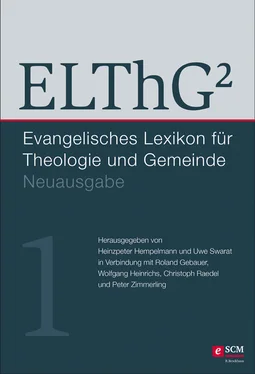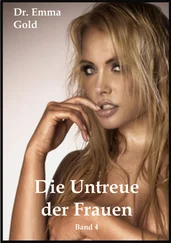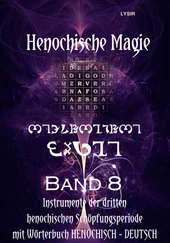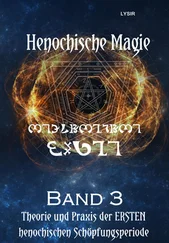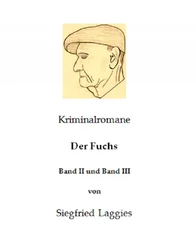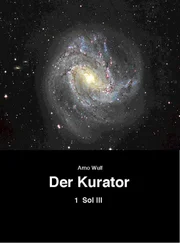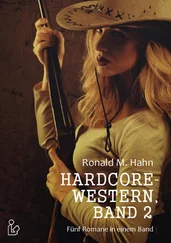Lit.: D. Dormeyer / F. Siegert / J.C. de Vos (Hg.): Arbeit in der Antike, in Judentum und Christentum, 2006; M. Hengel: Die Arbeit im frühen Christentum, ThBeitr 17/1986, Heft 4, 174-212; P. Herz: Die Arbeitswelt / Erwerbsmöglichkeiten, in: K. Erlemann u.a. (Hg.): Neues Testament und antike Kultur, Bd. 2, 2005, 186-189/190-198; B.F. Witherington: Work. A Kingdom Perspective on Labor, 2011.
C. Claußen
VI. ethisch
Die ethische Reflexion von A., ihr Stellenwert für die Wirtschaft und den einzelnen Menschen gründet in der philos. Einsicht in die grundlegende anthropologische Bedeutung, die die A. als Ort des verantwortlichen und gestaltenden Tätigseins des Menschen hat, und bezieht sich auf die Probleme, die sich aus der weitgehenden Überschneidung der A. mit der im ökon. Bereich organisierten Erwerbsarbeit ergeben.
Zu den in diesem Zusammenhang wichtigen ethischen Fragen gehören die Gestaltung von A.sbedingungen, insbesondere A.ssicherheit und A.sschutz, A.szeiten und A.sentlohnung. Aber auch die gesellschaftl. Wertschätzung des »Faktors Arbeit« im Verhältnis zu den anderen Produktionsfaktoren ist eine grundlegende sozialethische Frage. Hier hat die christl. Soziallehre trad. ein partnerschaftliches Verhältnis vertreten, wenn sie neben der Bedeutung der menschl. A. auch den wesentlichen Anteil anderer Produktionsfaktoren anerkennt. Zu diesen zählen das Eigentum, die unternehmerische Leistung und die ökon. Leistungsfähigkeit einer Wettbewerbswirtschaft. Außerdem tritt sie für eine wettbewerbliche und marktwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft ein. Die christl. Soziallehre verweist zugleich auf die gesellschaftl. Gestaltungsaufgabe, den Wirtschaftsbereich so zu ordnen, dass die menschl. A.sleistung in ihrem stark personalen Charakter bes. wertgeschätzt wird. Der A.smarkt ist kein beliebiger Markt, insofern Menschen aufgrund ihrer Personalität anders wahrzunehmen sind als andere »Produktionsfaktoren«. Das gilt zum einen hinsichtlich der Vergütung und Wertschätzung von A., die einen angemessenen Lebensunterhalt und gesellschaftl. Teilhabe ermöglichen muss. Es gilt zum anderen auch dahingehend, dass der Charakter von Erwerbsarbeit als von Personen getragenes Handeln im Blick bleiben muss. Die Rahmenbedingungen von A. müssen daher so gestaltet werden, dass der menschl. A. auch als Teil der Lebenszeit und Lebensäußerung von Personen Rechnung getragen wird. Umgekehrt steht aber auch der arbeitende Mensch selbst in seiner beruflichen A. unter dem ethischen Anspruch, als verantwortliche Person zu handeln und nicht zum unpersönlichen »Funktionär« zu werden.
Aus christl. Perspektive ist dabei geltend zu machen, dass die A. nicht nur instrumentell der Erwirtschaftung des eigenen Lebensunterhalts bzw. der Ressourcen für die eigene Lebensgestaltung dient. Sie ist zugleich als ein tätiger → Dienst am Nächsten zu verstehen, zu dem Gott befähigt und beruft, und in dem Christen Gottes Auftrag erfüllen (vgl. etwa Kol 3,23). Die aus der ökon. und sozialwiss. Sicht erwachsene Konzentration auf den »Faktor Arbeit« am A.smarkt und den Aspekt der Erwerbsarbeit stellt eine Verengung dar, bei der vielfältige Formen ehrenamtlicher, familiärer und zivilgesellschaftlicher A. nicht angemessen in den Blick kommen. Dem entspricht auch eine Verengung des Berufsverständnisses (→ Beruf I. soziologisch). Doch kommt gerade im Blick auf die großen Umbrüche in westlichen Gesellschaften in der Demografie und der Erwerbswirtschaft nicht-erwerbswirtschaftlichen, arbeitenden Tätigkeiten sowohl für das gesellschaftl. Miteinander wie für die Lebensgestaltung des Einzelnen großes Gewicht zu. Die christl. Sozialethik hat daher auf ihre Wertschätzung zu drängen, Modelle ihrer Ermöglichung zu fördern und daran zu erinnern, dass die Dimension des Dienstes am Nächsten wesentlich zum sinnerfüllenden Charakter von A. beiträgt.
Aus all dem folgen einerseits ein bes. Ethos und auch eine entsprechende Würde der Arbeit. Sie ist nicht nur äußere Notwendigkeit, sondern charakteristisch zum Menschen gehörende Aufgabe und → Verantwortung. Anderseits gibt es auch ein arbeitsspezifisches (»berufliches«) Ethos in der konkreten A., durch die jeder zu personaler Verantwortung in seinem konkreten Tun gerufen ist. In Spannung zu der hier betonten hohen Wertschätzung von A. als Teil des menschl. Lebens (die auch im diakon. Anliegen Ausdruck findet, Menschen mit → Behinderungen Möglichkeiten zur Teilhabe an A. zu bieten) steht umgekehrt die Tendenz christl. Soziallehre, den Wert menschl. Lebens nicht von seiner Produktivität, seiner A.sfähigkeit und »Lebensleistung« her zu verstehen. Daher ist einer Überbewertung des identitätsstiftenden Charakters eigener Arbeit bzw. Leistung entgegenzutreten, wobei diese Gefahr der Überbewertung gerade im Kontext christl. begründeter Dienstbereitschaft und eines entsprechenden Arbeitsethos eine bleibende Herausforderung darstellt.
Der Auftrag und die Berufung zu einem tätigen Leben und einem aktiven Dienst am Mitmenschen in der Welt (in den vielfältigen Möglichkeiten seiner Gestalt) sind ein wichtiger und charakteristischer Aspekt menschl. Lebens. Zugleich ist hervorzuheben, dass der Kern menschl. Personseins und menschl. Würde in der Gottesbeziehung, genauer: in der bejahenden Zuwendung und Beziehung Gottes zu seinem Geschöpf liegt. Erst von dort her kommt auch dem menschl. Handeln und Arbeiten seine besondere Würde zu.
Lit.: J. Kruse: Geschichte der Arbeit und Arbeit als Geschichte, 2002; weitere Lit. s.o. unter I. philosophisch.
H. Jung
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.