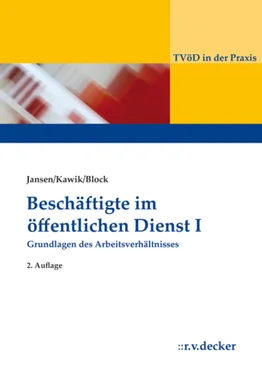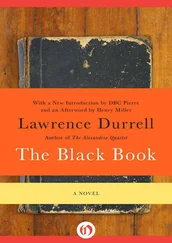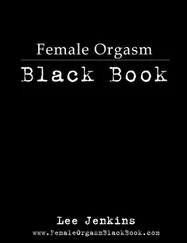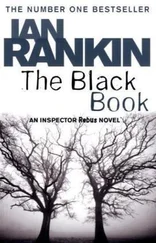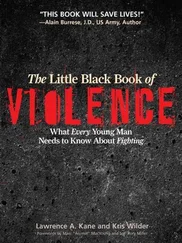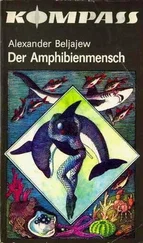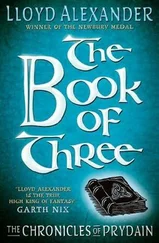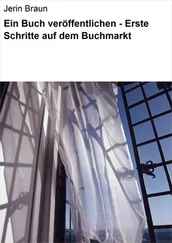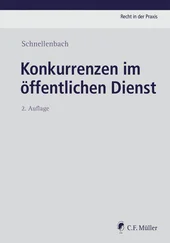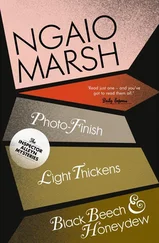Das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers unterscheidet sich jedoch schon vom Zustandekommen her wesentlich vom Dienstverhältnis des Beamten.
Während der Beamte durch Ernennung – Verwaltungsakt auf Unterwerfung – in ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis berufen wird, kommt das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers durch Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages – Arbeitsvertrag – zustande.
Trotz der enormen praktischen Bedeutung definieren die arbeitsrechtlichen Gesetze den Begriff des Arbeitnehmers nicht, sondern unterteilen ihn allenfalls in weitere Kategorien (Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Auszubildende), um den Anwendungsbereich des jeweiligen Gesetzes festzulegen. Die Rechtsprechung[1] und ganz herrschende Lehre[2] greifen auf die von Hueck[3] entwickelte, heute allgemein übliche Begriffsbestimmung zurück.
2
Danach ist Arbeitnehmer, „wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags zur Leistung von Diensten für einen anderen in persönlicher Abhängigkeit (Unselbstständigkeit) verpflichtet ist“. Beim Arbeitsvertrag handelt es sich um einen Sonderfall des Dienstvertrags nach § 611 BGB. Abs. 1 der Vorschrift regelt die Verpflichtungen der Vertragsparteien eines Dienstvertrags. Diese bestehen für den Dienstverpflichteten in der Leistung der versprochenen Dienste, für den Dienstberechtigten in der Gewährung der vereinbarten Vergütung. Kennzeichnend für den Dienstvertrag ist also die Leistung von Diensten gegen Entgelt. § 611 Abs. 2 BGB bestimmt, dass Gegenstand des Dienstvertrags jede Art von Diensten sein kann. Das Arbeitsverhältnis unterscheidet sich vom unabhängigen Dienstvertrag durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit, also der Fremdbestimmtheit der Dienstleistung. Der Arbeitsvertrag zeichnet sich durch die persönliche Abhängigkeit des Dienstverpflichteten gegenüber seinem Vertragspartner aus. Als weiteres Merkmal der persönlichen Abhängigkeit (Fremdbestimmtheit) ist die Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation heranzuziehen.[4] Die Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein Beschäftigter hinsichtlich Zeit, Dauer und Ort der Ausführung der versprochenen Dienste einem umfassenden Weisungsrecht (§ 106 S. 2 GewO) des Arbeitgebers unterliegt.[5]
Die 2016 in § 611a BGB eingefügte gesetzliche Definition des Arbeitnehmers schreibt lediglich die höchstrichterliche Rechtsprechung des BAG fest und greift die bisherigen Abgrenzungskriterien auf. Ob damit die missbräuchliche Gestaltung des Fremdpersonaleinsatzes durch Beschäftigung in vermeintlich selbstständigen Dienst- und Werkverträgen verhindert werden kann, muss die praktische Anwendung dieser Vorschrift zeigen.
2.Arbeiter und Angestellte/Beschäftigte im ö.D.
3
Die Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten ist in der geschichtlichen Entwicklung begründet und reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Die kleine Gruppe der Angestellten leistete überwiegend geistige, die Arbeiter überwiegend körperliche Arbeit. Wer schreiben können musste, wurde bereits den Angestellten zugeordnet.
Aufgrund der zunehmenden technisch anspruchsvollen Arbeitswelt und dem Übergang von der Industrieproduktion zur Dienstleistungsgesellschaft verlor die Unterscheidung zunehmend an Bedeutung. So hat denn auch der Gesetzgeber beginnend mit dem Jahr 1993 die Unterschiede beseitigt, indem er etwa einheitliche Kündigungsfristen eingeführt hat. Soweit heute – etwa in § 5 ArbGG – noch eine Differenzierung nach Arbeitern und Angestellten erfolgt, handelt es sich lediglich um eine Beschreibung, die an keine differenzierenden Rechtsfolgen mehr geknüpft ist.
3.Spezielle Statusbezeichnung nach TVöD/TV-L
4
Dieser Entwicklung hat auch der am 1.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD – Rechnung getragen, indem die bis dahin tarifrechtliche Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern aufgehoben und eine einzige Statusgruppe, nunmehr als Beschäftigte bezeichnet, geschaffen wurde. Die bis dahin maßgebenden unterschiedlichen Tarifverträge für Angestellte – BAT/BAT-O – bzw. für Arbeiter – MTArb/MTArb-O – sowie der Arbeiter im Bereich der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände – VKA – BMTG/BMTG-O – traten mit Ablauf des 30.9.2005 außer Kraft. Ergänzend sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder – TdL – mit Wirkung zum 12.10.2006 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vereinbart worden ist, der überwiegend mit dem TVöD identisch ist.
Soweit im Folgenden rein tarifrechtliche Grundlagen betroffen sind, findet der durch den TVöD/TVL neu geprägte Statusbegriff „Beschäftigte(r)“ Verwendung.
Wie auch immer die zweifelsohne unglücklich gewählte redaktionelle begriffliche Darstellung ausfällt, gemeint sind in jedem Falle Arbeitnehmer. Es ist ohnehin weder ersichtlich noch erklärbar, warum die Tarifvertragsparteien diesbezüglich wortschöpferisch tätig geworden sind. Insbesondere deswegen nicht, weil das allgemeine Arbeitsrecht mit der Bezeichnung Arbeitnehmer eine verständliche und umfassende Bezeichnung für den Personenkreis der aufgrund eines Arbeitsvertrages Beschäftigten entwickelt hat.
II.Struktur des Arbeitsrechts
5
Das Arbeitsrecht ist ein weitgefächertes in sich selbstständiges Rechtsgebiet mit eigener Gerichtsbarkeit. Zwar hat es noch keine lange geschichtliche Entwicklung hinter sich. Der weitaus größte Teil der diesem Gebiet zuzuordnenden Normen ist erst in den zurückliegenden 60 Jahren entwickelt worden. Dennoch hat die in der Gesamtbetrachtung rasche Entwicklung zu einer nahezu unüberschaubaren Rechtszersplitterung dieser Materie geführt. Bereits in den 70er Jahren wie auch in neuerer Zeit bestand und besteht die Absicht, das individuelle Arbeitsrecht in Form eines „Deutschen Arbeitsgesetzbuches“ zusammenzufassen und zu vereinheitlichen. Dieses Vorhaben hat sich jedoch bislang aufgrund fehlender politischer Entscheidungsfindung nicht weiter durchsetzen können.
6
Unsere Rechtsordnung unterscheidet zwischen Normen des öffentlichen und des privaten Rechts. Nach der (herrschenden) modifizierten Subjektstheorie gehören dem öffentlichen Recht diejenigen Rechtssätze an, die nur den Staat oder einen sonstigen Träger hoheitlicher Gewalt zum Zuordnungssubjekt haben, die sich folglich ausschließlich an den Staat oder einen sonstigen Träger hoheitlicher Gewalt wenden.
Dem Privatrecht sind demgegenüber die für jedermann geltenden Rechtssätze zuzurechnen. Das öffentliche Recht ist somit das Sonderrecht des Staates, das Privatrecht das Jedermannsrecht, wobei zu dem „jedermann“ auch der Staat gehören kann.
Das Arbeitsrecht besteht sowohl aus Normen des öffentlichen als auch privaten Rechts. Überwiegend sind diese jedoch privater Natur. Während der Betriebs-, Gefahren- und Arbeitsschutz öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, sind die Arbeitnehmerschutzrechte – insbesondere der Kündigungsschutz – rein privatrechtlicher Natur.
3.Gliederung des Arbeitsrechts
7
In sich ist das Arbeitsrecht nach Rechtsgebieten gegliedert, denen im Einzelnen wiederum die Vielzahl der wesentlichsten Rechtsquellen zugeordnet werden. Im Verhältnis zueinander lassen sie sich übersichtsmäßig wie folgt abgrenzen:
8
Unter Individualarbeitsrecht versteht man das Recht, Arbeitsverträge abzuschließen, deren Inhalt zu gestalten und bestehende Arbeitsverhältnisse zu beenden. Diesen Teilbereich des Arbeitsrechts bezeichnet man auch als Arbeitsvertrags- und Arbeitsverhältnisrecht. Seine Normen sind teils öffentlich-rechtlicher, im Wesentlichen allerdings privatrechtlicher Natur.
Читать дальше