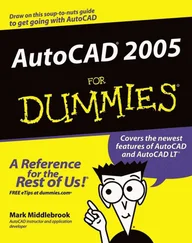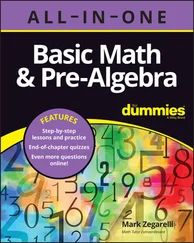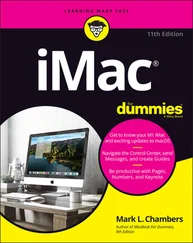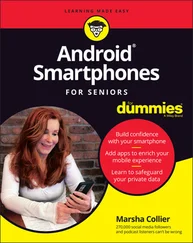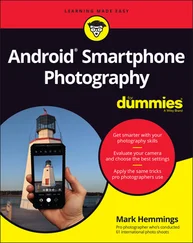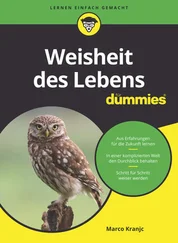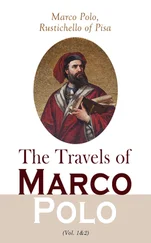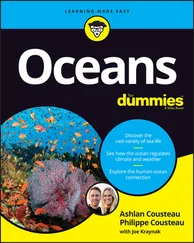Der Mensch im Mittelalter wachte morgens auf und fragte sich, ob er denn in den Himmel kommt, wenn er stirbt. Er lebte vollständig in dem Bewusstsein, dass da ein Gott ist, der die Sünder bestraft, dass es aber auch die Möglichkeit der Sündenvergebung und Errettung gibt. Ewige Verdammnis und ewige Seligkeit, Himmel und Hölle waren für ihn ständig gegenwärtige Möglichkeiten.
 Das Problem mit dem Tod war letztendlich, dass man sich nie ganz sicher sein konnte, ob man denn nun errettet oder verdammt war. Was, wenn man eine Todsünde beging und im nächsten Moment ohne Beichte und Vergebung starb? War man dann auf ewig »verloren«? Wie Sie im Laufe des Buches erfahren werden, brachte die evangelische Lehre den Menschen auch in dieser Hinsicht Befreiung.
Das Problem mit dem Tod war letztendlich, dass man sich nie ganz sicher sein konnte, ob man denn nun errettet oder verdammt war. Was, wenn man eine Todsünde beging und im nächsten Moment ohne Beichte und Vergebung starb? War man dann auf ewig »verloren«? Wie Sie im Laufe des Buches erfahren werden, brachte die evangelische Lehre den Menschen auch in dieser Hinsicht Befreiung.
Ein »guter Tod« war für die Menschen damals auch keinesfalls ein schneller, plötzlicher Tod. Das, was für viele Menschen heutzutage der schönste Tod wäre, war für die Menschen im Mittelalter etwas Furchtbares: Zu sterben, ohne sich vorbereiten zu können, ohne seinen Frieden mit den Mitmenschen und Gott schließen zu können – das war für sie ein schrecklicher Tod. Der schnelle Tod – das war im Mittelalter der schreckliche Tod.
Theologische Grundbegriffe: Die Todsünde
Die Katholische Kirche kennt die Möglichkeit, dass ein Mensch zwar von seinen Sünden erlöst, dann aber aufgrund bestimmter Sünden wieder verdammt wird (man sagt dann, er »fällt aus der Gnade«). Diese bestimmten Sünden sind die Todsünden. Um als Todsünde zu gelten, muss eine Sünde folgende Eigenschaften haben:Sie muss einen sehr wichtigen Bereich betreffen, also zum Beispiel gegen eines der Zehn Gebote verstoßen. Solche heiklen Bereiche sind zum Beispiel Ehebruch oder der Abfall vom Glauben (theologisch »Apostasie« genannt). Der Sünder muss diese Sünde ganz bewusst begehen, also vorher wissen, wie schwer sie ist, und sich damit bewusst gegen Gottes Gebot stellen wollen.Außerdem muss die Sünde aus freiem Willen begangen worden sein.
Todsünden entstehen aus sieben schlechten Charaktereigenschaften: Hochmut, Geiz, Zorn, Wollust, Völlerei, Neid und Trägheit. In Literatur und Kunst werden meist diese Charaktereigenschaften an sich als Todsünden bezeichnet. Theologisch ist das allerdings nicht ganz korrekt.
Wer also eine Todsünde begeht und zufällig stirbt, ohne »vollkommene Reue« zu zeigen oder die Beichte ablegen und bereuen zu können, ist auf ewig verloren – egal, ob er ansonsten ein guter Christ war. Die Notwendigkeit der Beichte zur Vergebung von Todsünden verstärkte natürlich den Einfluss der Kirche als Mittlerin zwischen Mensch und Gott.
Die Vergebung einer Todsünde ist bei »vollkommener Reue«, also »Reue aus Liebe zu Gott«, auch ohne Beichte möglich. Beichtet der Sünder einem Priester, wird ihm eine Todsünde auch bei »unvollkommener Reue«, also bei Reue aus Angst vor Gottes Strafe, vergeben.
Mit dem Konzept der Todsünde und diesem Rein und Raus »aus der Gnade« konnten sich die Reformatoren und eine Mehrzahl der evangelischen Christen bis heute nicht anfreunden. In den folgenden Kapiteln wird davon noch die Rede sein.
Lesen konnten die meisten Menschen nicht, aber in den Kirchen sahen sie den gekreuzigten Christus und wussten, dass er da am Kreuz hängt, um die Menschen in den Himmel zu bringen. Und noch eines wussten die Menschen: Wenn sie Errettung und ewiges Leben finden können, dann nur in der Kirche. Was immer wir heute im Rückblick auch darüber denken mögen, sollten wir doch versuchen, die Ängste unserer Vorfahren zu verstehen und ernst zu nehmen. Natürlich haben die Menschen vor 500 Jahren ganz anders gedacht als wir heute, aber sie verdienen doch trotzdem unseren Respekt und unser Bemühen um Verständnis.
 Auch wenn die ersten Kapitel von vergangenen Zeiten handeln, sollte man nicht vergessen, dass es auch heute immer noch viele Menschen gibt, die auf der Suche nach Gott, nach Vergebung und Erlösung sind. Vielleicht geschieht das heute oft ganz anders als im Mittelalter, aber die Suche nach Erlösung und ewigem Leben gab es damals wie heute.
Auch wenn die ersten Kapitel von vergangenen Zeiten handeln, sollte man nicht vergessen, dass es auch heute immer noch viele Menschen gibt, die auf der Suche nach Gott, nach Vergebung und Erlösung sind. Vielleicht geschieht das heute oft ganz anders als im Mittelalter, aber die Suche nach Erlösung und ewigem Leben gab es damals wie heute.
Die römische Kirche versprach Hilfe in diesen Glaubensängsten. Folgende Einrichtungen der Kirche ebneten den Menschen den Weg in den Himmel:
der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden,
die Heiligen, die genug gute Taten vollbracht hatten, um »normalen Gläubigen« etwas davon abzugeben,
das Fegefeuer, das nur zeitlich begrenzte Leiden umfasste und von den noch lebenden Angehörigen verkürzt werden konnte, und
die Messe, in der der einzelne Gläubige die Nähe Gottes und die Gemeinschaft mit Christus erfahren konnte.
Der Papst und die Einheit der Kirche
Auch wenn die katholische Kirche im Apostel Petrus ihren ersten Papst sieht, war das Oberhaupt der Gemeinde von Rom in den ersten Jahrhunderten lediglich der Bischof von Rom. Erst nach und nach entwickelte sich die herausragende Stellung des »Bischofs von Rom« als Herr über die ganze Kirche. Wichtiger Architekt dieser Konzentration der Kirche auf Rom war Papst Gregor VII. (Papst von 1073 bis 1085). In den nächsten Jahrhunderten arbeiteten viele Päpste an dieser Einheit der Kirche unter Rom, sodass bis zum 13. Jahrhundert in Westeuropa ein Kulturraum entstanden war, in dem alle einflussreichen Menschen aus Kirche, Wissenschaft und Politik Latein sprachen. Aus welchem Winkel des katholischen Europas man auch kam, mit Latein konnte man sich verständigen. Immer mehr gelang es den Päpsten, das kirchliche Leben von Rom aus zentral zu steuern. Und nicht weniger erfolgreich wurde die Kirche darin, das Leben der einzelnen Gläubigen zu kontrollieren und zu beeinflussen:
Die christliche Sicht auf die Sexualität geriet in eine totale Schieflage. Schon mit dem Auftreten der ersten Eremiten und Mönche stieg die Wertschätzung von Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit. Im Gegensatz dazu wurde die Sexualität bis zu dem Punkt entwertet, an dem sie gerade noch zur Fortpflanzung in der Ehe halbwegs »sündlos« praktiziert werden konnte.
Mit der Beichte, also damit, dass man dem Priester seine Sünden erzählte, erlangte man durch die Vermittlung des Priesters die Vergebung der Sünden und das Heil. So einfach – oder schwer? – war es für den einfachen Gläubigen, das ewige Leben zu haben. Wer eine »Todsünde« beging und starb, ohne beichten zu können, konnte nur in der Hölle landen. Wer aber seine Sünden bereute – auch die Todsünden! –, konnte sich durch den Zuspruch des Priesters der Vergebung gewiss sein.
Mit der »Erfindung« des Fegefeuers fand die Kirche einen Weg, die Verbindung zwischen den Lebenden und ihren verstorbenen Liebsten aufrechtzuerhalten. Denn viele Sünder mussten erst einmal durch das Leiden im Fegefeuer »gereinigt« werden, bevor der Weg in den Himmel frei war. Wie gut, dass die Hinterbliebenen es durch Gebete und (Geld-)Gaben in der Hand hatten, den Verstorbenen die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen.
Das Fegefeuer (lateinisch purgatorium, Ort der Reinigung)
Der Glaube an eine Art »Zwischenaufenthalt« der Toten wurde notwendig durch die katholische Ansicht, dass niemand in den Himmel kommen kann, der unrein ist. Wenn aber jemand zwar in der Gnade Gottes, aber ohne volle Vergebung der Sünden starb, war er eben noch nicht ganz fit für den Himmel. Von einem Zwischenaufenthalt der Verstorbenen gab es zwar auch in der frühen Kirche schon vage Ideen, aber erst Papst Gregor I. (der Große, Papst von 590 bis 604) baute das konkret in die katholische Glaubenslehre mit ein.
Bis zur Zeit von Martin Luther im 15. Jahrhundert war das System des Fegefeuers so weit ausgeklügelt, dass den Hinterbliebenen genau gesagt werden konnte, welche Gabe oder welches Gebet den verstorbenen Angehörigen wie viele Jahre im Fegefeuer ersparte. Letztendlich entzündete sich am Fegefeuer und dem damit verbundenen Handel mit der Vergebung der Sünden (Ablasshandel) der Protest Martin Luthers.
Читать дальше
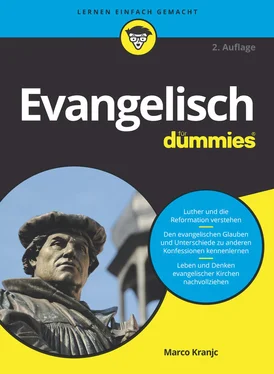
 Das Problem mit dem Tod war letztendlich, dass man sich nie ganz sicher sein konnte, ob man denn nun errettet oder verdammt war. Was, wenn man eine Todsünde beging und im nächsten Moment ohne Beichte und Vergebung starb? War man dann auf ewig »verloren«? Wie Sie im Laufe des Buches erfahren werden, brachte die evangelische Lehre den Menschen auch in dieser Hinsicht Befreiung.
Das Problem mit dem Tod war letztendlich, dass man sich nie ganz sicher sein konnte, ob man denn nun errettet oder verdammt war. Was, wenn man eine Todsünde beging und im nächsten Moment ohne Beichte und Vergebung starb? War man dann auf ewig »verloren«? Wie Sie im Laufe des Buches erfahren werden, brachte die evangelische Lehre den Menschen auch in dieser Hinsicht Befreiung.