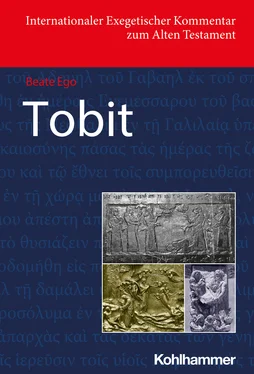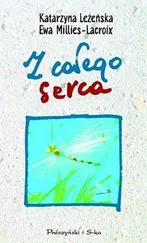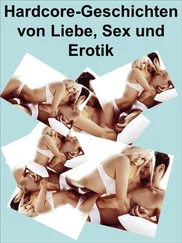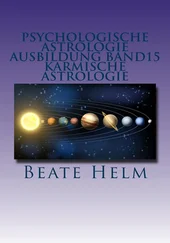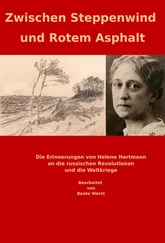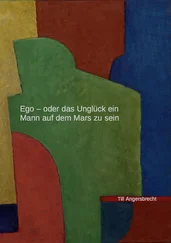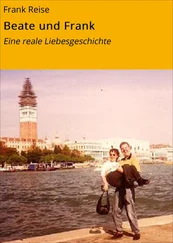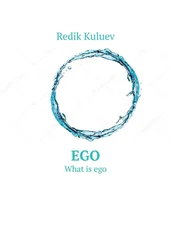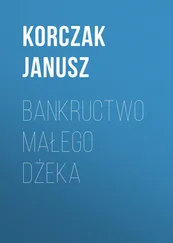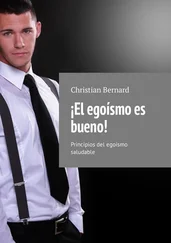Barmherzigkeitstaten, Armut und ReichtumDie Erzählung setzt das Milieu einer wohlhabenden Schicht voraus, und Tobit scheint – zumindest in seinen guten Jahren – ein reicher Mann gewesen zu sein. Hätte er nicht über ein bestimmtes Vermögen verfügt, hätte er seine Landsleute nicht in ihrer Bedürftigkeit unterstützen können (1,16–20; 2,2–7); auch die Mahnungen zum Almosengeben (4,6–11.16–17) oder zur korrekten Bezahlung eines Lohnarbeiters (4,14) ergeben nur dann Sinn, wenn sie sich an ein Publikum richten, das zumindest einen gewissen finanziellen Spielraum hat. Auch die Beschreibung seines Mahls deutet auf diesen Aspekt hin (2,1f.). Ein wichtiges Handlungselement, das mit dem Reichtum der Familie verbunden ist, ist das bei Gabaël im fernen Medien deponierte Vermögen (1,14), das durch die erfolgreiche Reise des Tobias wieder in den unmittelbaren Besitz der Familie kommt (vgl. 4,1.20; 5,3.6; 9,1–6; 10,2; 11,15; 12,3; oft mit expliziten Vor- und Rückverweisen 55). Auch die Heirat mit Sara hat positive Auswirkungen auf das Vermögen der Familie (8,21; 10,10; 14,13).
Aber auch Tobits Verwandtschaft macht einen prosperierenden Eindruck. Für Achikar ist das ganz offensichtlich (1,22), ebenso muss Saras Familie über gewisse finanzielle Freiheiten verfügt haben, wenn reichlich aufgetischt werden kann (7,9; 8,19f.; 9,6) und für die Reise der Brautleute auch Dienstpersonal und Reittiere zur Verfügung stehen (9,2.5).
Das Thema des Reichtums klingt auch durch den Namen „Tobit“ an, da er Assoziationen an die Familie der Tobiaden – einer begüterten Adelsfamilie im spät-nachexilischen Judentum – weckt (siehe zu 1,1).
Die Geschichte zeigt aber problematische Seiten des Reichtums: So findet sich in den Worten Hannas nach dem Abschied ihres Sohnes („Es soll ja nicht das Silber zum Silber kommen …“; 5,19f.) eine eindeutige Kritik an dessen Überschätzung, und die Fragilität des Reichtums bzw. des Besitzes wird durch Tobits eigenes Schicksal nur zu deutlich: Wegen der Unsicherheit auf den Straßen ist Tobit nach dem Regierungsantritt Sanheribs (704–681 v. Chr.) in seiner Aktivität als Fernhandelskaufmann eingeschränkt und kann somit nicht mehr seiner Erwerbstätigkeit nachgehen (1,15); als er wegen der Bestattung seiner Landsleute verfolgt wird, verliert er sein Vermögen (1,20), und nach seiner Erblindung ist er nicht mehr in der Lage, für seinen Unterhalt und den seiner Familie zu sorgen (so implizit durch 2,10 und 2,11). In diesen Situationen ist Tobit auf die Solidarität seiner Verwandtschaft (i. e. Achikar; 1,22; 2,10) bzw. seiner Frau (2,11) angewiesen.
Innerhalb dieses breiten biographischen Rahmens kommt der Wertschätzung solidarischen Handelns eine bedeutende Rolle zu. Die Begriffe ἀλήθεια, „Wahrheit“, δικαιοσύνη, „Gerechtigkeit“, und ἐλεημοσύνη, „Barmherzigkeit bzw. Almosen“, durchziehen die Erzählung wie ein roter Faden und können als Leitwörter gelten. 56Alle drei Begriffe finden sich gleich am Anfang (1,3) und kehren sowohl in den erzählenden Abschnitten als auch in Redeelementen unterschiedlichster Art wieder. Dabei können aber auch nur einzelne Begriffe der Trias erscheinen. Durch die verschiedenen Belege ergibt sich eine Sinndimension, welche die gesamte Erzählung überspannt: Die Begriffe werden am Anfang programmatisch eingeführt, dann durch die Handlung bestätigt, um schließlich in der Rede des Engels am Ende der Geschichte reflektiert und gleichzeitig auf die Zukunft hin entfaltet zu werden. 57Speziell die Gabe von Almosen (eine mögliche Übersetzung des Terminus ἐλεημοσύνη, die sich aus dem Kontext ergibt 58) wird in der Abschiedsrede Tobits thematisiert (4,6–11.16–17). In diesem Kontext erfolgt des Weiteren eine explizite Verbindung mit den göttlichen Geboten und Weisungen (vgl. die Rahmung 4,5 und 4,19). Zudem wird der Gebotsgehorsam mit der Wendung „Gottes gedenken“ zusammengefasst (4,5f.). 59Ein weiterer Rekurs auf die Thematik findet sich in der Rede des Engels (12,8–10; hier wieder alle drei Begriffe) sowie am Ende der Erzählung, wenn es heißt, dass Tobit auch nach seiner Erblindung weiterhin barmherzige Taten wirkte (14,2). Durch Tobits Rede vor seinem Tod wird der Anspruch einer solchen Praxis an die nächste Generation weitergegeben (14,8.9, ebenfalls alle drei Begriffe) und es erfolgt so eine Art „Verstetigung“ dieser Haltung. 60
Tobit wird als Vorbild eines solchen solidarischen Handelns präsentiert (vgl. den programmatischen Einsatz in 1,3), der sich auch in extremen Krisensituationen nicht vom praktischen Tun der Barmherzigkeit abhalten lässt. Er erweist – unter Einsatz seiner gesicherten Existenz – seinen mitexilierten Brüdern viele Barmherzigkeitstaten, indem er sie speist, bekleidet und bestattet (1,16–20; 2,2–7; vgl. ἐλεημοσύνη siehe 1,16). Trotz seiner persönlichen Krise, in der ihm seine Frau vorhält, dass seine Haltung der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu nichts nütze war (vgl. 2,11–14 mit ἐλεημοσύνη und δικαιοσύνη), bleibt er seinen Idealen treu. In seinem Gebet schickt er sich in seine Situation und betont Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit (3,1–6), und im Anschluss daran ermahnt er seinen Sohn zu einem Leben in Gerechtigkeit und Wahrheit (4,5f.).
Die gesamte Motivik impliziert einen narrativen Diskurs über den Tun-Ergehen-Zusammenhang. In Tobits Gebet (3,1–6) wird deutlich, dass „Barmherzigkeit“, „Gerechtigkeit“ (hier als Adjektiv) und „Wahrheit“ nicht nur menschliche Ideale, sondern auch göttliche Wirkgrößen darstellen (3,2). Insofern Gottes Handeln an Tobit als Barmherzigkeitshandeln zusammengefasst werden kann (11,17: ἐλεέω) und Tobit am Ende seines Lebens seinen Wohlstand auch wieder erlangt (14,2), steht die gesamte Motivik im Kontext eines funktionierenden Tun-Ergehen-Zusammenhangs: Derjenige, der seinen Nächsten barmherzige Taten erweist, erfährt auch die Barmherzigkeit Gottes. Dieser Zusammenhang wird in einem Subplot , d. h. einer Art Nebenhandlung, auch durch die Figur Achikars veranschaulicht, der als Exempel dafür dient, dass barmherziges Handeln letztlich belohnt wird (14,10f.). 61Am Ende der Erzählung soll dann in der Beschreibung des „Neuen Jerusalem“ mit seiner Lichtherrlichkeit (13,11; siehe auch 13,16f.) die spirituelle Dimension des Reichtums anklingen.
Tod und BestattungEin Sonderfall der Barmherzigkeitstaten ist die Bestattung. Tobit begräbt die Toten seines Volkes, die zu Opfern der Verfolgung wurden, als Ausdruck der Nächstenliebe (1,17–19; 2,3–8). Dieses Verhalten bringt ihm aber zunächst nur Unglück, da er vom König verfolgt (1,19f.) sowie von den Nachbarn (2,8) und auch seiner Frau (2,14) verspottet wird. Schließlich erblindet Tobit sogar in unmittelbarem Zusammenhang mit einer solchen Tat (2,9f.). In seinem Testament befiehlt er seinem Sohn, dass er ihn und seine Mutter würdig in einem Doppelgrab bestatten solle (4,3f.). Auf diesen Befehl, die Eltern zu bestatten, rekurriert Tobias, um zu begründen, dass er sein Leben nicht durch eine Heirat mit Sara riskieren möchte (6,15). Eine Ironisierung des Motivs findet während der Hochzeitsnacht statt, wenn der Brautvater Raguël in seiner Furcht, seinen künftigen Schwiegersohn könnte dasselbe Unglück ereilen wie dessen Vorgänger, ein Grab ausheben lässt (8,9f.), das dann aber glücklicherweise nicht benötigt wird, sodass er die Grube unbenutzt wieder zuschaufeln kann (8,18). Schließlich bestattet Tobias tatsächlich am Ende der Geschichte – in Entsprechung zur Lebenslehre Tobits (4,3) – seinen hochbetagten Vater (14,1.11), seine Mutter (14,12) und seine Schwiegereltern (14,13). Das Motiv ist nicht nur im Hinblick auf die Demonstration der Frömmigkeit Tobits bedeutsam, sondern zeigt auch, dass diese Frömmigkeit schließlich von Gott belohnt wird – ist es doch dieses Handeln, das den Engel Rafaël dazu bringt, das Gebet Tobits zu Gott zu bringen (12,12). In der Rede des Engels werden die negativen Folgen, die sich aus der Bestattung der Toten ergeben, auch als Probe interpretiert. Wenn der Sohn Tobias das Gebot der Elternbestattung, das zu der Weisheitslehre seines Vaters gehörte, befolgt, so zeigt er sich zudem als gehorsamer und vorbildlicher Sohn. 62
Читать дальше