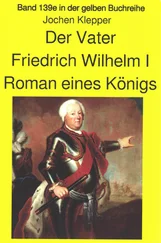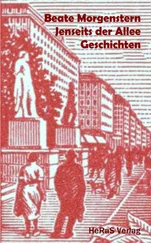Beate Klepper
Tumult der Seele
Lichtenberg und Maria Dorothea Stechard
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Beate Klepper Tumult der Seele Lichtenberg und Maria Dorothea Stechard Dieses ebook wurde erstellt bei
Motto Motto Ein Mädchen, die sich ihrem Freund nach Leib und Seele entdeckt, entdeckt die Heimlichkeiten des ganzen weiblichen Geschlechts; ein jedes Mädchen ist die Verwalterin der weiblichen Mysterien. G. Ch. Lichtenberg, Sudelbuch G, 80
I. VON BLUMENKINDERN UND TRAUMGESTALTEN
II.VON FREMDEN HÄUSERN
III. STERNE UND DRACHEN
IV. VOM LACHEN DER HEXE
V. IM UNHEILIGEN EHESTAND
VI. DER ZWEIFEL
VII. »SO LASSE ICH MIR SIE ANTRAUEN«
Zitierung und Quellen
Impressum neobooks
Ein Mädchen, die sich ihrem Freund nach Leib und Seele entdeckt, entdeckt die Heimlichkeiten des ganzen weiblichen Geschlechts; ein jedes Mädchen ist die Verwalterin der weiblichen Mysterien.
G. Ch. Lichtenberg, Sudelbuch G, 80
I. VON BLUMENKINDERN UND TRAUMGESTALTEN
Maria Dorothea Stechard hieß sie, und dieser Name mochte nicht viel mehr wert sein als das Papier, auf dem ihre Geburt und siebzehn Jahre später ihr Tod vermerkt wurden.
17 Jahr und 39 Tage wurde sie alt, um es so wiederzugeben, wie Lichtenberg es aufschrieb, so genau in seiner Art als Mathematiker und Astronom. Viel hatte er dann nicht mehr über sie geschrieben. Es gab dazu keine Notwendigkeit. Wäre sie seine Frau geworden, hätte er sicher noch weniger von ihr mitgeteilt. Nicht in dieser Art, in der Trauer, die alles nur im Guten zu sehen vermag. So weiß im Grunde niemand etwas über die Stechardin. Eine Unbekannte, die man hie und da erwähnt, wenn man von Georg Christoph Lichtenberg spricht; oder über die man besser schweigt?
Geboren wurde sie am 26. Juni 1765, als einziges Kind ihrer Eltern, und sie mussten Maria zum Friedhof bringen. Im August war das gewesen, im Jahr 1782.
Wie der Leichenzug wohl aussah? Sicher spärlich. Wer sollte schon mitgehen? Die Handvoll Leute, die die Stechards kannten, und die wenigen Freunde Georgs, die dieser Liebe mit Respekt begegneten. Und das waren wenige.
An den Fenstern werden dafür umso mehr Leute gestanden haben. Lauernd, glotzend, um Lichtenbergs Leid zu begaffen. »Professorenhure« hießen sie das Mädchen, und sie war bei weitem nicht die Einzige, die sie in Göttingen so riefen. Dann nannten sie Maria auch »Lichtenbergs Schöne«, und diese Wendung fanden sie so treffend, da Lichtenberg klein, verwachsen und bucklig war. Somit war dies für Maria kein Kompliment, lediglich eine Gemeinheit neidischer, kleinmütiger Geister.
Und durch die Straßen wanderte ein Gerücht von Ohr zu Ohr: »Habt Ihr gehört? Jetzt nach dem Tode gleicht sie sich völlig wieder und die Schönheit ist in ihr Gesicht zurückgekehrt. So blütenfrisch und gesund, wie sie immer war, soll sie als Leiche ausgesehen haben.«
Sie meinten die Rose am Kopf, den Rotlauf, der über das Gesicht gewachsen war und die Schöne entstellte. Und tatsächlich, wie zum Hohn und zum Spott trat die Rose zurück, sobald der Tod da war. Eine mögliche Laune der Natur.
Lichtenberg kam am letzten Tag nicht zu ihr ans Bett, weil er es nicht mehr mit ansehen konnte. Aber Maria zweifelte ja nicht, dass bald alles überstanden zu haben, dass sie bald wieder gesund vor ihm stünde. Die besten Ärzte der Universität hatte er kommen lassen, und diese schworen ihm, bei einer Königin hätte nicht mehr getan werden können. Er glaubte ihnen nicht.
Es dauerte nur acht Tage, dann ging es schnell zu Ende. Im Fieberwahn, der ihr den Geist benebelte und irre machte, schlich sich der Tod gnädig und unbemerkt ein. In der letzten Nacht um halb vier des Morgens rief sie Lichtenberg in einem Moment der Klarheit »Gute Nacht« zu. Hinüber in sein Studierzimmer rief sie, wo er wachte und nicht schlafen konnte.
Es gab auch einen Anfang, fünf Jahre zuvor, in dem Sommer, in dem Marias zwölfter Geburtstag anstand und sie die Schülerin des Professors Lichtenberg wurde. Beide ahnten nicht, wie schnell diese Begegnung sie in diesen Tumult führen würde, den süßen Tumult der Seele, der sie nicht mehr losließ.
Die Stechards waren Leinweber, deren Leben karg war, aber hungern - nein, hungern musste Maria nie. Arm waren viele in der Albani-Gemeinde und die Kinder verkauften Blumen. Von jeher boten sie auf dem Wall die Blumen feil, denn Betteln war verboten. Bereits als Kleine gingen sie mit, bekamen von den Älteren gezeigt, wie man die zarten Stängel der Veilchen und Primeln mit einem Grashalm zusammenband, wie man sie in ein Körbchen auf etwas Gras legte und vor der Sonne schützte. Frisch sollten sie bleiben, bis sie die Spaziergänger trafen, die reich genug waren, ein paar Pfennige zu geben. Das Pflücken der Blumen hinterließ grüne Flecken an den Fingern, die grasig rochen, und der Grasgeruch mischte sich mit dem süßlichen Duft aus dem Korb. Sie gingen mit schnellen Schritten, beflissener Freundlichkeit und wenig Sinn für das Vogelgezwitscher über ihnen in den Linden. Ihre Hände gaben die Blumen und nahmen die Münzen, um die sich die Finger fest schlossen, da dieses Geld heilig war. Jahraus, jahrein zogen sie los, von der Blüte der ersten Schneeglöckchen bis zum letzten Heidekraut, das am Weg zwischen den alten Mauern auf dem Wall stand. Wenn Maria zurückkam in das Haus, das doch fremde Haus, in dem sie nur als Mieter geduldet waren, legte sie das Verdiente auf Heller und Pfennig auf den Tisch. Sie glaubte fest, die Hand müsste ihr abfallen, wenn sie auch nur eine Münze unterschlagen hätte.
In diesem Frühjahr bemerkte man deutlich, sie hatte die Größe ihrer Mutter erreicht. Ihre Kleider passten nicht mehr, und das Schnürleibchen spannte über den Brüsten. Die Mutter gab ihr von ihren Kleidern, was sie abgeben konnte, und sah ihre Tochter dabei an, mit Blicken, als wollte sie sagen:
»Ach, mein armes Kind. Wie soll nur dein Leben werden?“ Doch die Mutter sagte nichts dergleichen, und Maria tat, als verstünde ich sie nicht.
Dabei verstand sie vieles, auch die Warnung: »Pass auf dich auf«, wenn sie auf den Wall ging, dann wusste sie, sie meinten die Männer, die die armen Mädchen für käuflich hielten und für billig, denn die Körper der Armen waren wenig wert. Die Kinder wussten dies alles schon immer, und es wurden keine Geheimnisse daraus gemacht. Man erzählte diese Geschichten über geschändete, geprügelte und gar verschwundene Kinder von jeher, und die Stimmen der Leute klangen dabei so gleichmütig, als unterhielten sie sich übers Brotbacken oder über ihre Legehennen. Und ihr Vater in seiner stoischen Ruhe sagte einmal:
»Die Not trägt viele Gewänder, und wo sie ist, hat man keine Zeit, darüber nachzudenken.« Nun stellte Maria sich die Not als eine üble Person vor, die vielleicht schon vor der Tür stand und jederzeit anklopfen konnte.
1. Kapitel
Der Rhythmus des Webstuhls war der Herzschlag der Weber. Das Klappen der Rechen drang aus den Häusern, durchzog sie bis unters Dach. Abends musste es für Maria als Wiegenlied herhalten, und kaum dämmerte der Morgen, setzten die Webstühle wieder ein. Man arbeitete mit dem lichten Tag. So wäre es immer gewesen, sagte der Vater. So hatte man zu arbeiten. Durch das Fenster fiel Licht auf den Webstuhl. Fasern tanzten in der Luft. Wenn Maria die Kettfäden aufspannte, schlug sie das offene Haar zurück, und man sah ihren langen, feinlinigen Hals. Es war der Hals ihrer Mutter. Beugte Greta Stechard sich am Webstuhl über ihre Arbeit, bemerkte man genau die gleiche Nackenlinie unter den Flauschhärchen, die aus dem Haarknoten gerutscht waren. Die Mutter war vor der Zeit gealtert, war hager und ausgezehrt. Aber Maria war jung, schoss gerade auf, wie die jungen Triebe im Garten. Maria habe auch die Augen ganz wie die Mutter, behauptete die uralte Frau Haberich, die oben in der Dachkammer wohnte.
Читать дальше