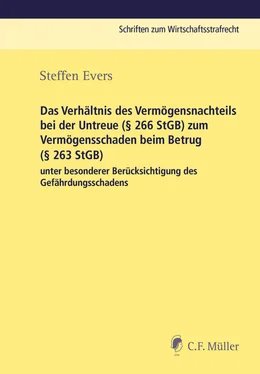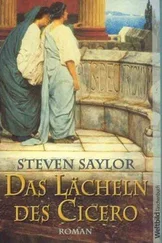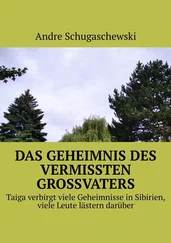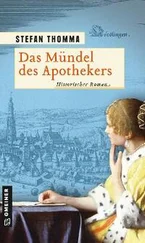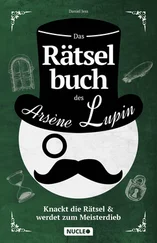1. Kanther – Schwarze Kassen im Rahmen einer politischen Partei
2. Siemens – Schwarze Kassen in der Privatwirtschaft: Konstellation 1
3. Schwarze Kassen in der Privatwirtschaft: Konstellation 2 – Erstreckung der Strafbarkeit auf den Alleingesellschafter
4. Ergebnis zur Ausweitung des Begriffs des Vermögensnachteils durch die Rechtsprechung – Die Erhebung der Dispositionsfreiheit zum Rechtsgut der Untreue
II. Ablehnung der Ausweitung des Nachteilsbegriffs aus dogmatischen, praktischen sowie systembezogenen Gründen
1. Dogmatische Gründe
a) Die Untreue als reines Vermögensdelikt
b) Die Aufgabe des einheitlichen strafrechtlichen Schadensbegriffs
c) Die Entwicklung der Untreue zu einem Korruptionsvorfelddelikt
d) Unterschiedliche Anwendungsbereiche des Regelbeispiels des § 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB beim Betrug und des § 266 Abs. 2 i.V.m. § 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB im Hinblick auf die Untreue
2. Praktische Gründe und der Einfluss der Rechtsprechung auf unternehmerisches Handeln
a) Inkompatibilität mit der Struktur unterschiedlicher Entscheidungsebenen in Wirtschaftsunternehmen
b) Die Mutation der Untreue zum strafprozessualen Mittel
3. Systembezogene Gründe – Rechtssicherheit vs. individuelle Gerechtigkeit
4. Schlussfolgerung – Die Ablehnung der Ausweitung des Nachteilsbegriffs
III. Zusammenfassung zur Ausweitung des Nachteilsbegriffs
C. Erfordernis restriktiver Anwendung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil (3./4. Möglichkeit)
I. Das Erfordernis der Restriktion des Schadensbegriffs und des Nachteilsbegriffs (3. Möglichkeit)
1. Verfassungsrechtliche Gründe für eine Restriktion
a) Das Gesetzlichkeitsprinzip: Art. 103 Abs. 2 GG
aa) Die Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil vor dem Hintergrund des Analogieverbots
(1) Das Analogieverbot als Grenze der Auslegung von Straftatbeständen
(a) Der Wortlaut als einziges taugliches Abgrenzungskriterium
(b) Die Ermittlung der natürlichen Wortbedeutung
(c) Zwischenergebnis
(2) Der begriffliche Inhalt von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(a) Der Begriff des Schadens
(b) Der Begriff des Nachteils
(c) Identischer Bedeutungsgehalt trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten
(d) Das Erfordernis der Vermögensminderung und die Bedeutung des Rechtsgüterschutzes
(e) Zwischenergebnis – Die wortlautbezogene Definition der Begriffe Vermögensschaden (§ 263 StGB) und Vermögensnachteil (§ 266 StGB)
(3) Die Verfassungskonformität der Schadens- bzw. Nachteilsbegründung durch Vermögensgefährdung
(4) Das Verhältnis von Rechtsgutsverletzung, Gefährdungsschaden und endgültigem sowie echtem Schadenseintritt im Hinblick auf den Wortlaut des Gesetzes
(5) Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.6.2010 (2 BvR 2559/08 u.a.) im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit des Gefährdungsschadens
(a) Die Verfassungsmäßigkeit des Gefährdungsschadens und das Verschleifungsverbot als abstrakte Anforderung
(b) Die (fehlende) konkrete Umsetzung der abstrakten Anforderung des Verschleifungsverbots im Rahmen des Urteils zur Siemens-Korruptionsaffäre
(6) Zwischenergebnis zur Vereinbarkeit der herrschenden Schadens- und Nachteilsdogmatik mit dem Analogieverbot
bb) Schlussfolgerung zu den Auswirkungen des Analogieverbots auf Vermögensschaden und Vermögensnachteil
b) Der Schuldgrundsatz (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG)
aa) Die Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil unter Berücksichtigung des Schuldgrundsatzes
(1) Die Schuld als Grundlage der Strafzumessung
(2) Die Notwendigkeit der Bezifferung von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(3) Die Notwendigkeit der Bezifferung zumindest eines Mindestschadens bzw. -nachteils
(4) Methoden der Bezifferung
(a) Das Bilanzrecht
(b) Die Barwertmethode
(c) Weitere wirtschaftswissenschaftliche, insbesondere statistische und finanzwissenschaftliche Methoden
(d) Die Zulässigkeit der Schadensschätzung
(e) Die Berücksichtigung des Marktpreises als einzig verlässliche Methode zur Bezifferung unter der Herrschaft des wirtschaftlichen Vermögens- und Schadensbegriffs
(f) Zwischenergebnis
(5) Der Gefährdungsschaden und die Notwendigkeit seiner Bezifferung
(a) Schwierigkeiten bei der Bezifferung von Gefährdungsschäden
(b) Die Zulässigkeit einer Ausnahme vom Bezifferungserfordernis
(6) Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.6.2010 (2 BvR 2559/08 u.a.) im Hinblick auf das Erfordernis der Bezifferung der Höhe von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(a) Die Notwendigkeit der Bezifferung des Erfolgsunrechts
(b) Die konkrete Umsetzung des Erfordernisses der Bezifferung im Urteil zum Berliner Bankenskandal
bb) Auswirkungen des Schuldgrundsatzes auf Vermögensschaden und Vermögensnachteil
c) Ergebnis zum Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus verfassungsrechtlichen Gründen
2. Wirtschaftspolitische Gründe für eine Restriktion
a) Die besondere Bedeutung der Risikogeschäfte für ein marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem und die Notwendigkeit einer klaren Grenzziehung
b) Die Arbeitsteiligkeit bei der Entscheidungsfindung
c) Zwischenergebnis – „Strafrecht als Linienrichter“
d) Exkurs: Der „Mannesmann-Prozess“ als Beispiel der Verquickung von Recht und Ökonomie
e) Ergebnis zum Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus wirtschaftspolitischen Gründen
3. Strafrechtspolitische Gründe für eine Restriktion
a) Ultima-ratio-Funktion, Subsidiarität und fragmentarischer Charakter – Die Besonderheit des Strafrechts verglichen mit außerstrafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten
aa) Die ultima-ratio-Funktion
bb) Die Subsidiarität als Ausfluss des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
(1) Alternativen zum staatlichen Strafen
(2) Anwendbarkeit des Grundsatzes der Subsidiarität im Wirtschaftsstrafrecht
(3) Subsidiarität des Strafrechts in der Konstellation bloßer Vermögensgefährdungen
cc) Fragmentarischer Charakter – Lückenhaftigkeit des Strafrechts als Folgerung aus der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
b) Strafrecht als „Spielball“ der Kriminalpolitik
c) Ergebnis zu dem Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus strafrechtspolitischen Gründen
4. Zusammenfassung zum Erfordernis der Restriktion des Schadens- und des Nachteilsbegriffs
II. Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs wegen abweichender Tatbestandsstruktur von Betrug und Untreue (4. Möglichkeit)
1. Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs aufgrund der tatbestandlichen Weite des Untreuetatbestandes im Vergleich zum Betrugstatbestand und die mögliche Verfassungswidrigkeit des Untreuetatbestandes
a) Der Untreuetatbestand vor dem Hintergrund des Erfordernisses hinreichender Bestimmtheit
aa) Die allgemeinen Anforderungen an die Bestimmtheit von Straftatbeständen
bb) Die Verfassungsmäßigkeit des Untreuetatbestandes im Konkreten
(1) Die Bestimmtheit des Merkmals der Vermögensbetreuungspflicht
(2) Die Bestimmtheit des Merkmals der Pflichtverletzung des Täters als normatives Tatbestandsmerkmal
(3) Die Bestimmtheit des Merkmals des Vermögensnachteils
cc) Zwischenergebnis
b) Die unterschiedliche Weite des Untreuetatbestandes im Vergleich zum Betrugstatbestand
c) Konsequenzen aus der unterschiedlichen Weite von Betrugs- und Untreuetatbestand für das Verhältnis der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil
Читать дальше