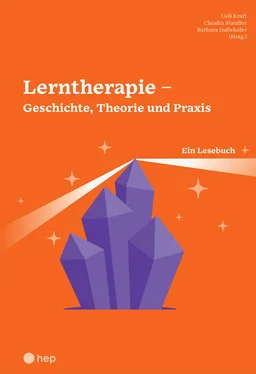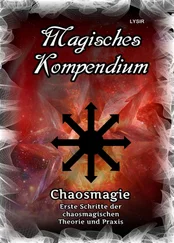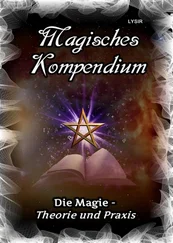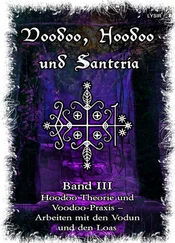Auffassungen der Tätigkeit und Rolle der Erziehungsberatung
Frühformen der – noch nicht so genannten – Lerntherapie entstanden vor allem im Rahmen der Erziehungsberatung (vgl. 2.1). Die gut vertretenen Arbeiten der ZfpP zu dieser Disziplin verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit – ich greife heraus, was auch für die heutige Lerntherapie relevant sein dürfte.
August Aichhorn – einer der Begründer der psychoanalytischen Pädagogik – zeigt sich als beinahe altmeisterlicher Virtuose auf der Klaviatur von Übertragung und Identifizierung – im Text gleichermassen bezogen auf Eltern und Kinder oder Jugendliche (1936). Obwohl er auch Überweisungen in Beobachtungsstationen, Heime und in die Psychiatrie vornimmt, bei gängigen Schulschwierigkeiten klärt er zunächst Lernhemmungen psychischer Art . «Die meisten von ihnen werden von der Schule ganz typisch mit 2 Sätzen charakterisiert: ‹Das Kind kann sich nicht konzentrieren›, ‹Es könnte viel mehr leisten, wenn es wollte›« (1932, S. 470). Die Hintergründe kann er nur verstehen, wenn die Klienten eine positive Übertragung (Eltern) oder Beziehung (Kinder) zu ihm entwickeln, Vertrauen fassen. Er bemerkt: «Bei Schulkindern ist bei einer ersten Begegnung gewöhnlich die Schule ein für unser Gespräch verbotenes Gebiet» (1936, S. 51). Er lässt seine Klienten erzählen, geht aufmerksam mit – ohne, «dass der Konflikt und das anamnestische Material» mit «Fragebogen oder auf Grund einer auszufüllenden Drucksorte in eine von uns bestimmten Reihenfolge» gebracht werden (1932, S. 451). Wichtigstes diagnostisches Mittel ist die Beobachtung im Spiel, im nichtanalytischen Gespräch, auf Spaziergängen mit dem Kind (vgl. 1936, S. 60–61). «Viele Kinder bleiben von der Schule weg, machen ihre Aufgaben nicht, arbeiten in der Schule nicht mit und stören den Unterricht, weil niemand da ist, der sich für ihre Leistungen und das Benehmen in der Schule interessiert, der gute Schulleistungen lobt und schlechte tadelt. […] Wir haben in hunderten von Fällen ohne Anwendung psychologischer Kunststücke [Hervorhebung UK] ausreichende Hilfe dadurch geboten, dass wir das Vertrauen der vorgestellten Minderjährigen gewannen. Wir verstanden ihre Beschwernisse und Kümmernisse und gaben ihnen die Möglichkeit, ihr unbefriedigtes Zärtlichkeitsbedürfnis bei uns unterzubringen». Die entstehende Übertragung führt nicht zuletzt dazu, dass das Kind dem Berater Freude machen will: «Sehr bald werden dann Schulbücher und Hefte mitgebracht, […] die Schulaufgaben gelernt und geschrieben, […] und vom Schulschwänzen ist in kürzester Zeit keine Rede mehr» (1932, S. 457f.).
Fritz Redl – unter anderem Kinderpsychoanalytiker und zusammen mit Aichhorn 1934–36 Leiter der Wiener Erziehungsberatungsstellen – macht sich Gedanken zur Terminologie des Begriffs Erziehungsberatung (1932, S. 523–532). Was dort faktisch gemacht werde, entspreche schon lange nicht mehr dem, was die Leute darunter zunächst verstehen würden – was auch Quelle von Widerständen bei einzelnen Eltern und Erziehern sei (in diesem Zusammenhang interessant der Beitrag von Hans Schikola: «Die narzisstische Kränkung der Eltern durch die Erziehungsberatung» [1932, S. 515–522]). Redl regt an, dass Erziehungsberatung primär als Beratung und Begleitung der Eltern verwendet werden sollte. Die Arbeit mit den Kindern oder Jugendlichen selbst sieht er zunächst im Dienst notwendiger Diagnosen, aber durchaus auch als pädagogische Erziehungshilfe dort, wo die Eltern – sei es aus Desinteresse oder Unvermögen – ihre Aufgabe unzulänglich erfüllen. Er schreibt weiter, dass beides in vielen Fällen nicht genüge, weil tiefer greifende therapeutische Unterstützung notwendig sei (1932, S. 527f.). Redl schlägt dafür nach längerer Diskussion den Begriff der Erziehungsbehandlung vor (a.a.O., S. 530). Er fordert, dass «den maßgebenden Instanzen die Begriffe Erziehungsberatung, Erziehungshilfe, Erziehungsbehandlung klar dargestellt werden» sollten. «Heute stehen wir einem Knäuel von Widerständen gegenüber, ihre Erledigung wird erschwert, wenn die dreischichtige Aufgabe mit dem Wort ‹Erziehungsberatung› bezeichnet wird» (a.a.O., S. 532).
1.3.3 Die psychoanalytische Pädagogik im Schweizer Exil
Der Faschismus der 30er- und der Kriegsjahre haben es mit sich gebracht, dass die Psychoanalyse nach der Flucht der Familie Freud aus Wien schwierige Zeiten durchlebte. Verschwunden ist sie allerdings auch in Deutschland nicht, die Schriften Sigmund Freuds blieben zugänglich und an den Hochschulen beachtet (vgl. Peglau, 2019). Die zentralen Konzepte wurden allerdings teilweise modifiziert verwendet – Wininger fragt im Titel seines Buches zur Rezeption der Psychoanalyse durch die akademische Pädagogik zwischen 1900 und 1945: «Steinbruch Psychoanalyse?» (vgl. 2011, S. 262). Der von der ZfpP gepflegte psychoanalytisch-pädagogische Austausch kam aber zunächst einmal zum Erliegen. Ernst Federn – Psychoanalytiker und Gewaltforscher, 1938–1945 als Jude und Antifaschist in Lagerhaft – schreibt: « … die eigentliche Psychoanalytische Pädagogik gab es nur mehr bei Hans Zulliger in Bern» (1993, S. 75).[2]
Zulliger ist schon in sehr frühen Jahren mit der Psychoanalyse in Kontakt gekommen.[3] Aus einfachen Verhältnissen stammend, lernte er in seiner Zeit am Bernischen Lehrerseminar den damaligen Direktor Ernst Schneider kennen, welcher von der neuen Lehre sehr begeistert war und im Psychologie-Unterricht seine Seminaristen damit vertraut machte – seine Vorgesetzten waren davon allerdings weniger angetan und entliessen ihn bald wieder. Zulliger arbeitete in der Folge als Lehrer und blieb der Psychoanalyse treu, freundete sich mit Oskar Pfister und Hermann Rorschach an, unterzog sich einer Psychoanalyse und tauchte einige Jahre später bei der ZfpP auf. Wahrscheinlich hat ihm Schneider den Weg ins Herausgeberteam geebnet. Er war mit Freud und seinem Kreis vertraut und freundschaftlich verbunden (besonders eng mit Aichhorn), wurde ernst genommen und steuerte die Idee der Gruppe zur psychoanalytischen Pädagogik bei. Obwohl er sein ganzes Arbeitsleben als Dorfschullehrer in Ittigen verbrachte, publizierte er äusserst produktiv Fachbücher[4] und Zeitschriftenartikel, die auch in der akademischen Welt weit herum beachtet und übersetzt wurden.
Unumstritten war auch er nicht: Die Nazis setzten eines seiner Werke auf die Liste der verbotenen psychoanalytischen Bücher. Auch in der Schweiz hatte Zulliger auf der Hut zu sein. Er schreibt:
Am Anfang betrieb ich das, was man heutzutage als, ‹kleine psychoanalytische Kinderpsychotherapie› bezeichnen würde. Ich tat es nach dem Vorbilde Pfisters, nachdem ich mich selber hatte analysieren lassen und neben Pfisters auch zahlreiche Schriften Freuds […] studiert hatte. Es war während einer Zeit, da die Psychoanalyse auch in der Schweiz in heftigster Weise angefochten wurde. Deshalb musste ich mit äußerster Vorsicht vorgehen. Also arbeitete ich gänzlich im Stillen, befreite einzelne Schülerinnen und Schüler von störenden Symptomen wie Lernhemmungen, Bettnässen, Stottern, reaktiver Aggressivität und Sich-nicht-einfügen-Können in die Gemeinschaft, Schuldgefühlreaktionen wegen Onanie, zwanghaften Diebereien – und ich hatte Anfängerglück. Darüber aber redete ich mit niemandem, um ungestört zu bleiben (zitiert nach Kasser, 1963, S. 38).
In den Nachkriegsjahren galt er als einer der wichtigsten Kinderanalytiker, wurde als Pädagoge gar in die Liga von Pestalozzi und Rousseau gerückt und erhielt 1952 den Ehrendoktor der historisch-philosophischen Fakultät der Universität Bern. Zu dieser akademischen Ehrung soll Zulliger bemerkt haben, seit er den Dr. h.c. habe, werde er wenigstens mehr in Ruhe gelassen. 1955 folgte ein weiteres Ehrendoktorat der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg – Zulliger wurde auch in Deutschland als einer der führenden Pädagogen und Kindertherapeuten gesehen. In der Schweiz folgten Lehraufträge an den Universitäten Bern und Zürich. Er hat den Test seines Freundes Hermann Rorschach um eine Kurzform erweitert, welche breit eingesetzt wurde. Und er hat – durch den Ersten Weltkrieg um die Möglichkeit eines eigenen Hochschulstudiums gebracht – mit seiner wunderbar einfachen, klaren und direkten Sprache viele Menschen erreicht, von Akademikern bis zu ungebildeten Eltern im Rahmen seiner erziehungsberaterischen Praxis.
Читать дальше