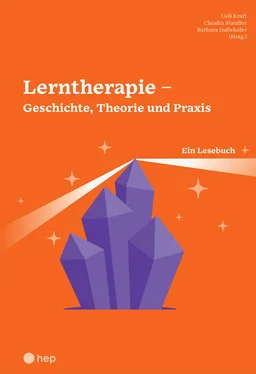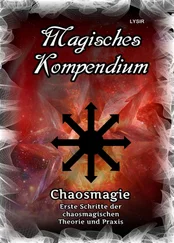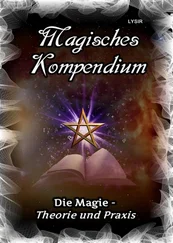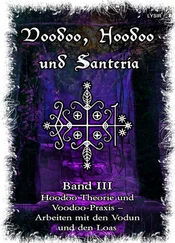Im Zusammenhang mit unserem Anliegen war ich überrascht, dass mir dies in all den Jahren noch nie aufgefallen war: Was ich 1959 als Kind auf einer Erziehungsberatungsstelle erlebte, war nach heutigem Verständnis eine psychologisch-therapeutische Lerntherapie. Sie ging die Schwierigkeiten an, welche hinter dem Symptom gestörten Lernens lagen – und beseitigte damit auch die Lernprobleme nachhaltig.
Anzumerken ist weiter: In der Schweiz war die Bezeichnung «Erziehungsberatung» für Dienststellen, welche sich mit schulpsychologischen Fragestellungen befassten, damals die gebräuchlichste. Allerdings zeichnete sich in den 50er- und 60er-Jahren bereits ab, dass die schulpsychologischen Dienste eher nahe der Schule selbst und in Kooperation mit der Heilpädagogik operierten, während die Erziehungsberatungsstellen ihre Arbeit eher psychologisch-therapeutisch verstanden. Ich entnehme dies Käser (1993), welcher die Entstehungsgeschichte der Schulpsychologie in der Schweiz seit 1920 in Bern detailliert nachgezeichnet hat. Zu diesen Anfängen verweist er (2016, S. 16) auf eine UNESCO-Konferenz zur Schulpsychologie von 1954 in Hamburg, welche in ihrem Bericht Folgendes lobend unterstreicht: «Die Schweiz war dank den Bemühungen Claparèdes in Genf (1912) und Heggs in Bern (1920) eines der ersten Länder mit psychologischen Diensten überhaupt.» Er übernimmt dies nach Hegg, S. (1977, S. 105), welche weiter aus dem Bericht zitiert:
Die Erziehungsberatungsstelle der Stadt Bern, die 1920 von Dr. Hegg gegründet wurde, ist zum Beispiel eine selbstständige Einrichtung innerhalb des schulärztlichen Dienstes. Ihre wichtigsten Aufgaben sind die psychologische Beratung der Schulen, die Erfassung, Untersuchung und psychotherapeutische, heilpädagogische oder andere Behandlung von schwierigen oder zurückgebliebenen Kindern und die allgemeine psychologische Aufsicht über die Sonderklassen der Stadt. (A.a.O., S. 105)
In diesem Pflichtenheft könnte der Begriff der Lerntherapie ohne Probleme untergebracht werden. Grund genug, uns vertiefter mit dieser verblüffenden Frühgeschichte zu beschäftigen.
1.3 Zur Frühgeschichte dessen, was wir heute Lerntherapie nennen
Datiert vom 3. März 1910, erhält Paul Häberlin, der spätere Ordinarius für Philosophie, Pädagogik und Psychologie der Universität Bern, einen Brief von Sigmund Freud. Dieser hoffte, ihn in seinen Kreis aufnehmen zu können, und schreibt unter anderem die folgenden Zeilen: «Ich weiss, dass die Psychoanalyse in Beziehung zur Pädagogik treten muss, kann aber selber nichts da für thun. Ich weiss auch, dass sie zur Selbsterziehung mächtig anregt und dass man grosse innere Widerstände überwinden muss, ehe man sich ganz mit ihr befreunden kann …» (zit. nach Hegg, S., 1977, S. 77).
Bevor Häberlin 1914 in Bern Professor wurde, hatte er in Basel Theologie studiert und in Philosophie, Zoologie und Botanik promoviert. Seine Beziehung zu Freud hatte sich über seine Freundschaft mit den Psychiatern Robert und Ludwig Binswanger angebahnt und war für seine Theoriebildung von grosser Bedeutung – obwohl er sich mit der Lehre Freuds nie völlig hat befreunden können. «Trotz aller Hochschätzung der durch die Psychoanalyse gewonnenen psychologischen Einsichten musste er die Lehre in ihren Grundlagen ablehnen, da die Weltanschauung und die Anthropologie, welche dahinter standen, einseitig naturwissenschaftlich-biologisch orientiert waren» (a.a.O., S. 77). Häberlin selber schreibt:
Religiöser Glaube, ethische Norm, und was damit zusammenhing, durfte nicht zu Recht bestehen, musste ‹zeranalysiert› werden, bis nichts anderes übrig blieb als nackter Trieb. Die psychoanalytische Theorie war mehr als Psychologie, sie entsprang aus anti-autoritativer Einstellung und mündete wieder in eine Art von kulturellem Nihilismus oder Relativismus. (Dies gilt sicher nicht von der Persönlichkeit Freuds, wohl aber von seiner Theorie.) (1959, S. 55).
Diese Reserviertheit hinderte ihn allerdings nicht daran, Person und Werk hoch zu schätzen, den Diskurs mit Freud auch persönlich zu führen und von ihm «starke Anregungen» für eine «wirklich psychologische Psychologie» zu gewinnen, welche ihm vorschwebte (a.a.O., S. 52). Seine Studenten hatten sich mit der Psychoanalyse vertraut zu machen – so auch Hans Hegg, der nachmalige Mitintiator und Leiter der bernischen Erziehungsberatung, deren Geschichte seine Tochter Suzanne Hegg minutiös aufgearbeitet hat (Hegg, S., 1977).
1.3.1 Zur Entstehungsgeschichte der bernischen Erziehungsberatung – ein Lehrstück
Die Geschichte – ich folge ab hier Suzanne Hegg (1977, S. 40ff.) – beginnt 1917 mit dem fortschrittlichen Schularzt Paul Lauener, welcher in Bern während der schwierigen Jahre während und nach dem Ersten Weltkrieg versuchte, seine Aufgabe nicht nur medizinisch zu fassen. Er kümmerte sich um Kinder, Jugendliche, Lehrlinge und deren Familien in Nöten.
Endlich kamen hinzu die vielen Klagen über Schule, Lehrer und Schulschwierigkeiten … Kurz, alles, was schief ging in der Schule [,] kam schliesslich vor unsere Ohren […] und da ich mich allein mit einer Schulschwester dieser Lawine gegenüber fand, bestand die Gefahr, von ihr erdrückt zu werden. Zudem war ich in keiner Weise dazu ausgebildet, mich nur einigermassen allen diesen Fragen gegenüber gewachsen zu fühlen. Da halfen auch die besten Schriften von Pestalozzi bis Häberlin nur eben so viel, uns die Schwierigkeiten nur noch deutlicher vor Augen zu führen.» (Lauerner, 1957; zitiert nach Hegg, S., 1977, S. 41f.).
Lauener fand in der Folge 1920 in der Person des mittlerweile promovierten Hans Hegg den gesuchten Fachmann – die beiden dürften damals bereits befreundet gewesen sein (vgl. Hegg, S., 1977, S. 42). Die Historikerin Hoffmann beschreibt in ihrer Lizentiatsarbeit zum Wirken Laueners diesen Einstieg so:
Hegg wünscht die Tätigkeit des Schularztes auf psychologischem Gebiet zu unterstützen und stellt sich der Schuldirektion hierfür vorerst ohne Honorar zur Verfügung – wogegen der Gemeinderat nichts einzuwenden hat. Zuvor hat sich Lauener selbst als Berater in Erziehungsfragen betätigt und seit 1918 eine ‹stark frequentierte› Elternsprechstunde angeboten. Der Schularzt ist es also, der die Erziehungsberatung in Bern begründet. 1920 überträgt der Gemeinderat diese Aufgabe mit Hegg einem Psychologen und Pädagogen und erweitert gleichzeitig das Schularztamt offiziell um eine Beratungsstelle für Erziehungsfragen (2008, S. 18).
Hegg – ich folge hier wieder dem Bericht seiner Tochter – begann also in einem Hinterzimmer des Schularztamtes (das für alle Zwecke gebraucht wurde) in Teilzeit zu arbeiten – ein Pionier ersten Ranges. Er versuchte parallel dazu zwar eine eigene Praxis aufzubauen, was aber daran scheiterte, dass er sich auf dem Schularztamt (wo die Beratung kostenlos war) selber konkurrierte. Im zweiten Jahr erhielt er für die psychologischen Untersuchungen, die er im Auftrag des Jugendamtes oder des Armeninspektorates vornahm, eine bescheidene Vergütung von 3 bis 5 Franken, ab 1922 zwar ein Salär von 4800 Franken pro Jahr, aber noch lange keine Anstellung. Er konnte sich, mittlerweile verheiratet, finanziell über Wasser halten, indem er ab 1925 jeweils circa 5–6 Pensionäre mit Schul- und Erziehungsschwierigkeiten in seinem Haus aufnahm und betreute. Eine feste Anstellung als Erziehungsberater der Stadt Bern (im Nebenamt) erhielt er erst 1943.
Die Idee einer Stelle für Erziehungsberatung war 1920 für Bern und für die ganze Schweiz etwas völlig Neues. «Ihre Entwicklung verlief mühsam und harzig und blieb während Jahrzehnten an ihren Begründer, Hans Hegg, gebunden, der sich das Unternehmen zur Lebensaufgabe gemacht hatte» (Hegg, S., 1977, S. 37f.). Er wurde auch angefeindet:
Die Lehrerschaft machte während Jahren Front gegen die neue Institution, da sie sich selbst als zuständig für alle Erziehungsfragen erachtete. Dazu sei sie kraft ihrer Ausbildung kompetent, war noch in den 40er Jahren in der ‹Schweizerischen Lehrerzeitung› zu lesen, obwohl damals die Lehrerschaft schon lange zu einer ‹Hauptkundin› der Erziehungsberatung geworden war. […] Ein Vertreter der medizinischen Fakultät, seines Zeichens Pädiater, bezeichnete die Erziehungsberatung kurz nach ihrer Gründung als eine ‹Bierkateridee›, die von allem Anfang an zum Scheitern verurteilt sei. Zuständig für Erziehungsfragen erklärte er den Kinderarzt, der die familiären Verhältnisse am besten kenne und zu beurteilen vermöge (a.a.O., 1977, S. 45f.).
Читать дальше