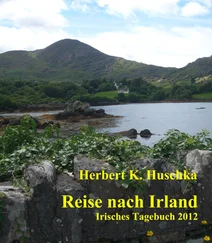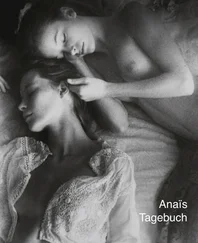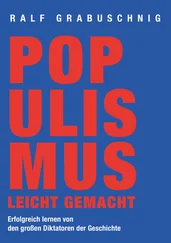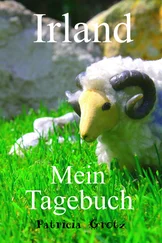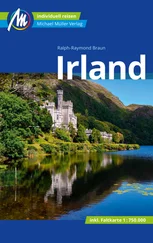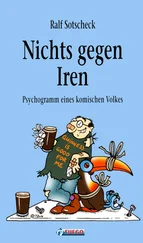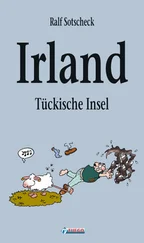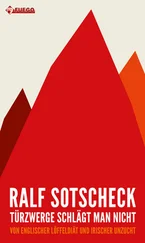Plötzlich stimmt einer der Musiker »The Town I Loved So Well« an, ein melancholisches, politisches Lied über Derry in Nordirland. Im Nu kehrt Ruhe ein. Wer spricht, wird von den Umstehenden mit einem energischen »Psst« zum Schweigen gebracht. Selbst im lautesten Pub wird einem Sänger diese Höflichkeit entgegengebracht – wohl deshalb, weil er es schwerer als die Instrumentalmusiker hat, sich gegen den Lärm durchzusetzen.
O’Donoghue’s gehört bei den Anhängern irischer Volksmusik zu den bekanntesten Dubliner Wirtshäusern. Hier hat man den US-Senator Robert Kennedy zu einem Lied überredet, und hier haben sich die »Dubliners« kennengelernt und zum ersten Mal zusammen gesungen. In der Ecke hinter dem Musikantentisch hängen die gerahmten Porträtzeichnungen der bärtigen Bandmitglieder. An der gegenüberliegenden Wand klebt das Werbeplakat ihrer Deutschlandtournee im November 1976. »The Dubliners, Irlands berühmteste Folkgruppe«, steht da auf Deutsch. Die Rundreise führte die Band damals nach Münster, Köln, Kiel, Hannover, Berlin und in dreizehn weitere deutsche Städte.
Die »Dubliners«, von denen keins der Gründungsmitglieder noch am Leben ist, sind im Ausland auch heute noch das Aushängeschild der irischen Musik und tingeln nach wie vor um den Globus. Sie erwecken mit ihren rauen Trinkliedern und rebel songs den Eindruck, als seien sie die authentischen Vertreter einer kontinuierlichen Tradition. Irland verfügt zwar über die lebendigste Musiktradition Europas, doch von einer ungebrochenen Entwicklung kann keine Rede sein: Mitte des 20. Jahrhunderts war die traditionelle Musik in Irland fast ausgestorben. Die Dubliner Regierung hatte sie fast zu Tode geschützt: Hatten die englischen Besatzer die irischen Traditionen, die ihnen als Ausdruck eines Nationalbewusstseins suspekt waren und gefährlich erschienen, über Jahrhunderte unterdrückt, so machte sich der neue irische Freistaat nach seiner Gründung 1922 sogleich daran, die überlieferten Sitten und Bräuche zu pflegen – aber auf bürokratische Art und Weise. Die Regierung legte fest, welche Tänze, Lieder und Gesangsstile »unirisch« waren, und verbot sie kurzerhand. Genauso waren Instrumente wie Klavier, Schlagzeug und Banjo verpönt, weil sie das »Reinheitsgebot« der Regierung nicht erfüllten. Noch 1980 schrieb der Musikexperte Padraig O’Dufaigh in der Zeitschrift Treoir: »Nicht jedes Instrument passt zur irischen Musik. Geige, Blechflöte, Dudelsack, Querflöte und Akkordeon eignen sich am besten für echte irische Musik. Wir müssen einschreiten, wenn wir nicht wollen, dass die große Flut von außen, die unsere Heime überschwemmt, unsere Musik ertränkt.«
Der Dudelsack gilt als typisch schottisches und irisches Instrument. Tatsächlich gibt es jedoch siebzig verschiedene Arten aus aller Welt. »Der Vorteil gegenüber dem schottischen Dudelsack liegt darin«, sagte der aus einer Familie von Fahrenden stammende berühmte piper Finbar Furey einmal, »dass man beim Spielen des irischen Dudelsacks Bier trinken kann.«
Die Zeiten, als die Furey-Brüder bei Sessions – oder seisiúns, wie das mehr oder weniger spontane Musizieren im Irischen heißt – im Pub auftraten, sind vorbei. Heute füllen sie Konzertsäle. Es gibt aber eine ganze Reihe Nachwuchs-Piper, die, wenn man Glück hat, bei einer solchen Session auftauchen. Schon mit ihrer Lautstärke dominieren sie das Geschehen. Einundzwanzig Jahre dauert es, so sagt man, bis ein Musikant den Dudelsack beherrscht: sieben Jahre lernen, sieben Jahre üben, sieben Jahre vervollkommnen.
Die besten Musiker Nordirlands – und dazu gehören zahlreiche piper – spielen im Crosskeys Inn, dem schönsten Pub der Grünen Insel. Er ist nicht leicht zu finden, obwohl es an der Straße von Portglenone nach Randalstown inzwischen ein kleines Hinweisschild gibt. Wie alt die Kneipe ist, weiß niemand genau. Es könnten gut zweihundertfünfzig Jahre sein, wie eine Untersuchung des strohgedeckten Daches ergeben hat. Früher führte die Hauptstraße von Belfast nach Derry am Pub vorbei. Dort, wo heute der Parkplatz ist, wechselte die Postkutsche die Pferde. Die gekreuzten Schlüssel sind Teil des Wappens von St. Patrick, dem Schutzpatron Irlands. Patrick war auch der Heilige des alten Ordens der Hibernier, der regelmäßig im Crosskeys Inn tagte. Damals gab es in dem Laden auch Lebensmittel sowie ein Postamt. Davon künden uralte Rechnungen im Schankraum. Am Nachmittag, wenn der Pub noch recht leer ist, wirkt er wie ein Museum: An der Decke hängen unter anderem ein hölzerner Zigarettenautomat, eine Gasmaske aus dem Ersten Weltkrieg, eine Muskete; im Flur gibt ein hundertfünfzig Jahre altes Plakat Ratschläge, wie man die Kartoffelpest besiegen kann, verblasste Reklametafeln werben für längst vergessene Genüsse.
Doch abends, wenn sich der Pub füllt, ist von Museumsatmosphäre keine Rede mehr. Dann legen die Musiker im big room los. Touristen und Einheimische drängeln sich an den kleinen Tischen im Kerzenschein und bugsieren Tabletts voller Guinness oder Bushmills durch die Menge. Der Whiskey – in Irland schreibt man ihn im Gegensatz zu Schottland mit »e« – stammt aus der ältesten Brennerei der Welt an der Nordküste Irlands. Älter als Bushmills ist die Tradition der Schwarzbrennereien in den versteckten Stichtälern Nordirlands. An der Wand im Crosskeys Inn hängt ein Bleistiftporträt von Mickey McIlhatton, dem legendären Schwarzbrenner, der in den glens von Antrim hochwertigen, aber illegalen poteen – einen farblosen, starken Kartoffelschnaps – hergestellt hat. Der IRA-Mann Bobby Sands, der 1981 im Hungerstreik starb und kurz vor seinem Tod zum Unterhaus-Abgeordneten gewählt wurde, hat im Gefängnis ein Lied über den »King of the Glens« geschrieben. Christy Moore, Irlands Folksänger Nummer eins, hat den Song aufgenommen: »Im Glenravels-Glen, da lebt ein Mann, den manche als Gott bezeichnen würden; denn er heilt ihr Zittern, und eine Flasche von seinem Zeug kostet dich gerade mal dreißig Kröten: McIlhatton, bitte schön.«
Wenn sich die Musikanten die Seele aus dem Leib spielen und im big room kein Durchkommen mehr ist, dann wird schon mal die Küche für die Gäste geöffnet, und im Handumdrehen beginnt eine zweite Session. Wenn in dem riesigen Kamin, wo Kessel und Töpfe am Haken hängen, ein Feuer lodert und knisternd die Musik untermalt, dann versteht man, warum die Fremdenverkehrszentrale in diesem Pub einen Werbefilm gedreht hat.
Seltener trifft man bei Sessions auf Harfner. Dazu ist das Instrument wohl zu unhandlich und zu leise. Die Harfe beherrschte jedoch über Jahrhunderte die irische Musik. Sie wurde solo gespielt oder zur Begleitung von langen epischen Gedichten eingesetzt, die von den filidh vorgetragen wurden, den Hofpoeten von hohem sozialen Rang. Harfenmusik war die Kunstmusik der keltischen Society, die Musik der Oberschicht. Sie bestimmte, verbunden mit Tänzen und Gedichten, einen großen Teil des keltischen Lebens. Mit der zunehmenden Anglisierung Irlands begann der Niedergang der Harfner. Zwar spielten sie zunächst für beide Bevölkerungsgruppen, doch mit dem Ende der gälischen Zivilisation nach Cromwells Sieg 1649 war ihr Untergang nicht mehr aufzuhalten. Die Barden, die bis dahin eine untergeordnete Rolle spielten, begannen nun, eigene Lieder und Gedichte zu schreiben. Ihr Publikum kam, wie sie selbst, vor allem aus der Unterschicht. Doch die Hungersnot Mitte des vergangenen Jahrhunderts machte auch ihrer Musik ein Ende: In einer Zeit, in der die Bevölkerung durch Hungertod und Auswanderung auf die Hälfte dezimiert wurde, stand niemandem der Sinn nach Musik.
Die Versuche der kulturellen Wiederbelebung, die mit dem neuen Nationalbewusstsein Anfang des 20. Jahrhunderts unternommen wurden, wären fast an der Kulturpolitik des jungen irischen Freistaats und seiner rigiden Interpretation des »Irischseins« gescheitert. In den vierziger Jahren interessierte sich niemand mehr für irische Musik – man hörte amerikanische Schlager. Aus den USA kam jedoch auch der Anstoß, der der irischen Musik zu neuem Leben verhalf: Im Zug der Folk-Welle, ausgelöst durch Woody Guthrie, entstanden zahlreiche Balladengruppen irischer Emigranten, die amerikanische Einflüsse mit ihren traditionellen Liedern kombinierten. Die ersten waren die Clancy Brothers, die schon bald zu Plattenmillionären wurden. Ihr Erfolg sprach sich auch in Irland herum: »Es gab einen Folk-Boom, der kommerziell ausgenutzt wurde und meilenweit von den Quellen der Erneuerung irischer Musik entfernt war«, sagte der Musiker David Hammond. »Für viele Menschen klang das alles andere als angenehm.«
Читать дальше