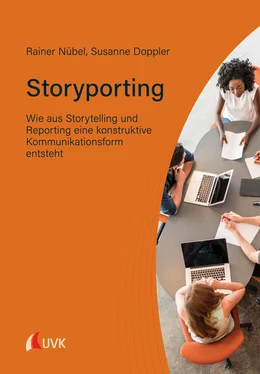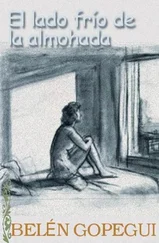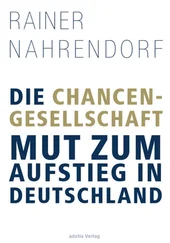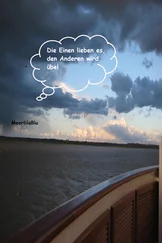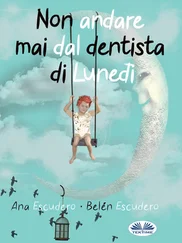Lebensmittel mit lokalem und regionalem Bezug werden als authentisch, rein und traditionell wahrgenommen (Kauppinen-Räisänen et al . 2013) und kreieren eine Atmosphäre der Wahrhaftigkeit. Dies bietet auch Anknüpfungspunkte für Inszenierungen, in denen das Esserlebnis angereichert wird durch themenbezogene Erzählungen(Doppler et al. 2020). Das Fine-Dining-Restaurant The Fat Duck beispielsweise bietet Gästen eine ‚Reise‘ an, die der Gast mit der Reservierung seines themenbezogenen Restaurantbesuchs beginnt (The World’s 50 Bests Restaurants 2017; The Fat Duck o. J.). Diese Reise erzählt in einem luxuriösen 15-Gänge-Menü die wichtigsten Urlaubserinnerungen aus der Kindheit des Inhabers Heston Blumenthal. Auch in Norbert Nierkoflers Drei-Sterne-Michelin-Restaurant in Südtirol (Italien) werden z. B. nur biologisch erzeugte Lebensmittel aus der Region verwendet. Der Küchenchef erzählt sein Konzept unter dem Slogan „Den Berg kochen“ mit Verweis auf die Idee, die nachhaltige Landwirtschaft in der Region zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine eigene Erzählung, eine Geschichte über Tradition, Herkunft, Erbe und gesundes Essen (Beller 2019).
Im Bereich Social-Media-Content spielt Täuschu ngTäuschung eine relevante Rolle z. B. im Kaufentscheidungsprozess. Im Umgang mit Influencer:innen warnt Gebel (2020, S. 137) in seinem Buch Social Media im Tourismusmarketing , das sich an Praktiker der Tourismusbranche wendet, davor, Content auf Instagram zu beschönigen, da dies das Vertrauen der User:innen empfindlich stört. Social-Media-Rezipient:innen tendieren dazu, die Story ihrer Reise im ‚besten Licht‘ und möglichst so darzustellen, dass sie Follower:innen gefällt. Vor allem Influencer:innen neigen dazu, Inhalte, die dem ‚perfekten Leben‘ nicht entsprechen, wegzulassen, wodurch eine weniger realistische Story und Szenerie entsteht (Bennet 2014, S. 71). Eine von den beiden Autor:innen dieses Buchs betreute, unveröffentlichte Bachelorarbeit (Stengel 2020) untersuchte im Kontext von Tourismus, ob und wenn ja wie Instagram-Posts von Influencer:innen zu Täuschung von Reisenden beitragen und inwiefern der Kaufentscheidungsprozess dadurch beeinflusst wird. Dazu wurden Kriterien zur Beurteilung von Täuschung literaturbasiert abgeleitet. Neben weiteren Kriterien ist der Grad, inwieweit Fakten vertrauenswürdig vermittelt werden und Reisekonsument:innen zwischen Storytelling und Fakten unterscheiden können, ein valides Kriterium, um Täuschung durch Social-Media-Content zu beurteilen. Ein Ergebnis der Arbeit ist, dass Reise-Content auf Instagram insgesamt ein hohes Täuschungspotenzial hat, wobei Mega-Influencer:innen deutlich stärker dazu neigen als Mikro-Influencer:innen (ebd.).
Konstruiertes Reality-Storytelling
Auch die öffentliche Dokumentation einer genuin sich dem Öffentlichen entziehenden Privatheit ist potenziell narrativ (Grimm/Krah o. J.). Daher soll nachfolgend auch kurz die Inszenierung von Reality-Events am Beispiel von Koch-Events kurz beleuchtet werden. Die Fernsehsendung Kitchen Impossible lässt in einem inszenierten Kochduell den Fernsehkoch Tim Mälzer jeweils gegen einen bzw. in einer Best-Friends-Edition 2021 auch gegen zwei Kontrahent:innen aus der Michelin- und Gault&Millau-Szene antreten (TVnow o. J.). Die Kontrahent:innen schicken sich gegenseitig in Restaurants oder auch in Privatküchen rund um die Welt, wo sie sich der Herausforderung stellen, in der für sie fremden Küche ein Gericht zu kochen, das sie zuvor nur einmal vor laufender Kamera serviert bekommen. In drei ineinander verflochtenen Erzählebenen erleben die Zuschauer:innen zum einen die Zubereitung des Gerichts durch beide Kontrahent:innen, während zweitens der Originalkoch des Gerichts den Zuschauer:innen seine eingeübte Zubereitung des Gerichts vorführt und dann in einer dritten Erzählebene ein nachträgliches Gespräch zwischen den Kontrahent:innen das Duell reflektiert, kommentiert und auch das Vorgehen des Originalkochs in Teilen den Kontrahent:innen filmisch vorführt, was ebenfalls kommentiert wird. Die Mission des Fernsehkochs Tim Mälzer, der in diesem Format als der David gegen die Goliaths der Restaurantszene antritt, lautet: Emotionalität der Gerichte, bei der es darum geht, dazu zurückzukehren, was ein gelungenes, beglückendes Essen ausmacht. Er verteidigt diese Mission gegen die intellektuellen, von Technik getriebenen Kreationen der Sterneküche (Bernard 2021). Tim Mälzer wird dabei auf einer Heldenreise inszeniert, auf der er als ‚Antiheld‘ für die Rechte der ‚antiintellektuellen Normalos‘ eintritt und diese gegen den ‚Snobbismus‘ der Luxus-Küche, der Privilegierten und Reichen verteidigt.
Verkürztes Reality-Storytelling
Dem Potenzial des Storytellings, Information zielgruppenspezifisch zu vermitteln, Problemlösungen zu kommunizieren und Emotionen hervorzurufen, stehen auch die Risiken gegenüber, durch zu starke Komplexitätsreduktion in Geschichten falsche Vorstellungen zu erzeugen und zu manifestieren bis hin zu Manipulationsmomenten(Fischer/Storksdieck 2018).
Der Ausbruch des Coronavirus Covid-19 löste im Februar/März 2020 in Deutschland und ganz Europa eine Pandemie aus. Krankheiten und Todesopfer generierten und transportierten ständig auch eine gesellschaftliche Narration (Horx 2021) und die Coronakrise hat beispielhaft gezeigt, dass vor allem in nichtfaktenbasierten Narrativen große Probleme und Risiken liegen.
Für die Auswirkungen auf die Hospitality-Branche steht stellvertretend die weltweit für ihre Après-Ski-Bars und Partys bekannte Tourismus-Destination Ischgl. Unter Freizeit-Ski-Tourist:innen galt die Alpen-Destination als das „Mekka der Spaßgesellschaft“, das „Ibiza der Alpen“ (Schüle 2021) und das „Epizentrum des alpinen Massentourismus“ (Deutsche Welle o. J.). Das Skigebiet umfasst 45 Liftanlangen, auf etwa 1.600 Einwohner kommen rund 12.000 Betten. Zahlreiche Hotels und Restaurants von gehobener Qualität sind in Ischgl ansässig und locken in der Ski-Saison Gäste aus aller Welt mit Luxus, abwechslungsreichen Ski-Pisten und Party-Tourismus (ebd.). Bereits Ende Februar 2020, als das Coronavirus in Deutschland und Österreich noch nicht nennenswert ausgebrochen war und Erfahrungswerte mit dem Virus fehlten, wurden im Norden Europas erste Reiserückkehrer aus Ischgl positiv auf das Virus getestet. Bis Mitte März 2020 steckten sich in Ischgl mehrere hundert Tourist:innen und Service-Mitarbeiter:innen mit dem Virus an. Das Virus verbreitete sich von Ischgl aus nach ganz Europa, als Reiserückkehrer:innen ohne infektionsvermeidende Kontrollen in ihre Heimat zurückreisten (sz.de 2020). Seither kämpft der Ski-Ort mit seinem Image, mit seinem ausufernden Luxus-Partytourismus einzig Schuldiger für die Corona-Ausbreitung in Europa zu sein, und wurde belegt mit verkürzten Narrati veNarrationverkürzte nwie z. B. „Corona-Hotspot“, „Kein zweites Ischgl“, „Aus Ischgl nichts gelernt“. Diese Kurz-Narrative stehen bis heute stellvertretend für Managementfehler in der Coronapandemie (Schüle 2021). Hier werden sogenannte narrative, sprachliche Fram esFrames erzeugt (Schach 2019, S. 163–165), die mit Bewertungen verbunden sind (ebd., S. 164). Die in der Coronakrise in Ischgl erzeugten Frames stehen bei Rezipient:innen fortlaufend als ‚Sinnbild‘ für z. B. überzogenen Luxus-Partytourismus und unverantwortliches Handeln, das der Marke Ischgl lange anhaften wird (Mike Peters in sz.de 2020).
Конец ознакомительного фрагмента.
Читать дальше