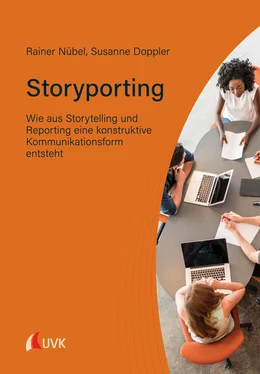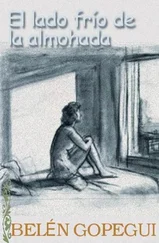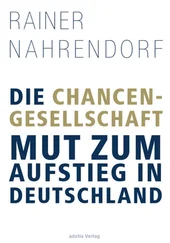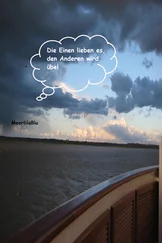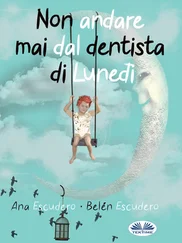Der Besuch einer Veranstaltung geht für Konsument:innen immer mit Erlebnissen einher, die nach Bruhn und Hadwich (2012) Ausdruck finden in den sechs Dimensionen Sensorik, Emotion/Affektion, Kognition, Verhalten, Lifestyleund Soziales. In Anlehnung an diese sechs Dimensionen identifiziert Drengner (2014) im Kontext von Events die relationale, die atmosphärische, die sensorische, die intellektuelle, die symbolische und die transzendale Erlebnisdimension, die alle sechs auf die emotionale/affektive Dimension einzahlen. Außergewöhnliche Erlebnisse sind mit einer starken Ausprägung der emotionalen Dimension verbunden, die Drenger (2014) als den zuvor genannten sechs Dimensionen übergeordnet kategorisiert und die bei Events mit einer starken Ausprägung der transzendenten und der relationalen Erlebnis-Komponenten einhergeht. Die transzendente Erlebniskomponente beschreibt dabei eine zeitweise Entkopplung des Selbst vom Alltag durch das Eintauchen in eine Welt. Die relationale Erlebniskomponente beschreibt Erfahrungen, die aus der sozialen Interaktion mit anderen Teilnehmern resultiert (Drengner 2014). Der Soziologe Hartmut Rosa konkretisiert diese relationale Komponente in seiner Soziologie der Weltbeziehung mit dem Konstrukt der Resona nzResonanz als Antwort auf die Hyperindividualisierung, die Abgrenzung voneinander und die Digitalisierung der Gesellschaft (Rosa 2020). Der Begriff drückt aus, dass Menschen in Beziehung treten zur Welt, zu anderen Menschen, zur Arbeit, zu Hobbies, zu Freizeitaktivitäten und zur Natur und in diesem In-Beziehung-Treten ein ‚vibrierender Draht‘ zwischen Menschen und der Welt entstehe (ebd., S. 24). Dieser vibrierende Draht wird laut Rosa gebildet durch intrinsische Interessen, wie z. B. Liebe, das Interesse an der Welt und durch intakte Selbstwirksamkeitserwartungen, also menschliche Erwartungen, die jeweilige Sphäre über diesen vibrierenden Draht zu erreichen und in ihr etwas zu bewegen, sie zu berühren und im Gegenzug aus der Sphäre heraus berührt zu werden (Rosa 2020, S. 24f.).
In inszenierten Narrationen entstehen transzendente Erlebnisfelder, in welche die Teilnehmer:innen eintauchen, diese in der Gemeinschaft erleben (relationale Dimension) und in diesem Erlebnis Resonanz erfahren (Doppler et al. 2021). Dabei werden in der Konzeption der inszenierten Narration nach (Fischer/Storksdieck 2018) sechs Dimensionen festgelegt: Das Set-up für Handlung und Rezeption (z. B. ein Messestand, ein Hotelzimmer), die Tonalität (z. B. persuasiv/‚überredend‘, informativ-faktenbasiert, dialogisch, moralisch), die Medialität der Erzählung (z. B. mono-, crossmedial, transmedial), der Plot der Erzählung (z. B. Abenteuer-, Rätsel- oder Erlösungsgeschichte), das Thema der Erzählung (z. B. ‚Zukunft der Mobilität‘ am Beispiel der IAA Mobility oder ‚An einem Tag um die Welt‘ im 25hours Hotel The Trip in Frankfurt am Main) und die Modalität der Erzählung (z. B. interaktiv, immersiv).
Im Kontext von Veranstaltungen sind große Erzählungen, wie z. B. die des Festivals Tomorrowland , und kleinere Narrationen, wie z. B. Inszenierungen zu Jubiläen und Festen, etabliert. Es werden fiktionale Narrationen von non-fiktionalen Narrationen unterschieden, wobei non-fiktionale Narrationen die Handlung als etwas Vorgefundenes erzählen, also Begebenheiten miteinander verbinden, die sich tatsächlich so ereignet haben und von Fake-Narrationen unterschieden werden müssen (Köhler 2019). Für virtuelle Welten unterscheiden Drengner/Wiebel (2020) authentische Objekte, die entweder existent, nicht mehr existent oder noch nicht existent sind, von artifiziellen Objekten, die fantastische Welten und dazugehörigen Objekte darstellen, wie z. B. Mittelerde und Hobbits.
Fiktionales StorytellingStorytellingfiktionales erfolgt häufig sehnsuchtsmotiviert (z. B. Paradies) oder literarisch (z. B. Märchen, Mythen). Märchen sind fiktionale Erzählformen, die oftmals einen moralischen Ansatz verfolgen und aufklärerische oder erziehungsrelevante Funktionen erfüllen (Fischer/Storksdieck 2018). Im Eventmanagement entwerfen große fiktionale Narrationen Erlebniswelt enErlebniswelten, wie beispielsweise die Fantasiewelt des jährlich stattfindenden Festivals Tomorrowland. Das Festival öffnet jedes Jahr ein neues ‚Buchkapitel‘ und entführt seine Besucher in fantastische Erzählungen einer besseren Welt, in der die Festivalbesucher:innen als People of Tomorrow in Frieden, Harmonie und Verbundenheit mit der Natur leben. Zuletzt fand das Festival unter dem Motto „Tomorrowland around the World“ im Coronajahr 2020 als digitaler Stream statt. Über eine Million Menschen aus der ganzen Welt wurden in die digital geschaffene Welt The Magical Island Pāpiliōnem entführt, eine fiktive Insel in Schmetterlingsform. Acht Bühnen und über 60 Künstler:innen konnten vor überdimensional großen, märchenhaft gestalteten Bühnenbildern und Lichtershows, die auf einer Bühne z. B. Anklänge an Pandora aus dem Film Avatar zitieren, digital-live erlebt werden (siehe dazu beispielsweise das offizielle Aftermovie (Tommorrowland 2020). Typischerweise werden diese Narrationen in den drei Phasen Pre-, Live-, Post-Event über alle genutzten Medienkanäle gespielt, mit dem Ziel, die Besucher:innen bereits vor dem Event in eine Welt zu entführen, schon in der Pre-Event-Phase einen dramaturgischen Spannungsbogenzu erzeugen und das Live-Event in die Pre- und Post-Phase zu verlängern. Die Zuschauer:innen tauchen früh in diese Welt ein und erzählen über Empfehlungen und eigene Posts bereits in der Pre-Event-Phase ihr eigenes Erleben der Geschichte und erleben das eigentliche Event als Höhepunkt der Narration.
Auch aus dem internationalen Sportgeschehen sind fiktionale Narrationenbekannt, wie z. B. das jährliche Medienspektakel anlässlich der Super-Bowl-Halftime-Show-Inszenierungen der NFL. In der Show 2017 beispielsweise reitet Katy Perry auf einem überdimensionierten Tiger in die Halftime-Show ein und fliegt im weiteren Verlauf am Ende der Show als Sternschnuppe singend durch das Stadion. Aber auch die großen Eröffnungszeremonien der Olympischen Spiele entwerfen kulturelle und historische Narrationen, wie z. B. das russische Geschichtsballett zu Beginn der Winterspiele in Sotchi 2014 (Süddeutsche Zeitung 2014).
Auch im B2B- und B2C-Messegeschehen werden fiktionale Erlebniswelten für Markeninszenierungen geschaffen. Die Audi-Inszenierung „Hängende Stadt“ im Rahmen der IAA 2013 beispielsweise bot den Besucher:innen einen Perspektivwechsel, um das Thema Mobilität aus einem ungewohnten Blickwinkel zu betrachten, neue Sichtweise zu eröffnen, technologische Innovationen aktiv zu erleben und Anforderungen an Mobilität der Zukunft mittels Fiktion zu visualisieren. Dazu wurde ein 3.400 m² großer, ‚schwebender‘ Pavillon geschaffen, in dem der städtische Raum von der Decke hing, Straßen und Autos mittels Spiegelung medial an die Decke projiziert wurden (siehe dazu Schmidhuber o. J.).
Non-fiktionales StorytellingStorytellingnon-fiktionales
Non-fiktionale Narrative im Eventmanagement nehmen ihren Ursprung z. B. in persönlichen Biografien, in Produkthistorien und -entwicklungen, in unternehmensinternen Kontexten wie z. B. Teambuilding-Maßnahmen, aber auch in komplexen Themen und Inhalten, wo faktuales Storytelli ngStorytellingfaktuales komplexe Sachverhalte in glaubhafte Geschichten (Murgia/Bormet 2021) und Bilder (Varga/Ehret 2016) übersetzt. Im touristischen und Hospitality-Bereich werden Bezüge sehr häufig in kulturellen, lokalen und regionalen Kontexten verankert, z. B. in traditionellen Bräuchen (Pferdeparaden, Umzüge, Mittelaltermärkte), nostalgisch motiviert (z. B. Seventies) oder auch mit Bezug zu Trends und Lifestyles (z. B. alles in Weiß, urbane Nomaden, Go Green) (Gruner et al. 2014, S. 122).
Читать дальше