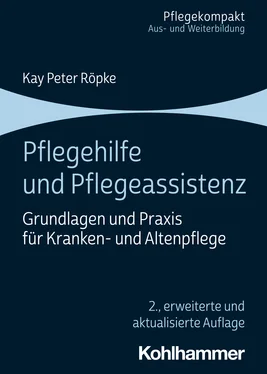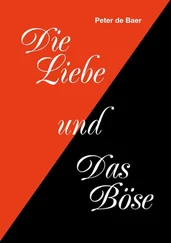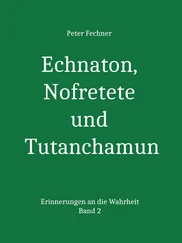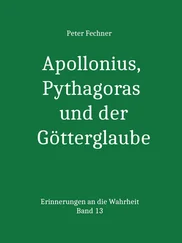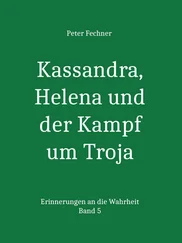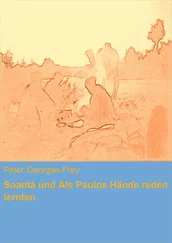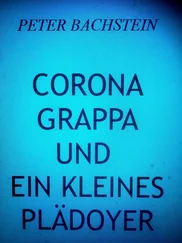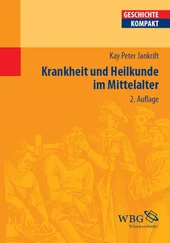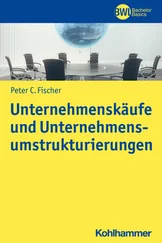• Gezielte Bewegungen sind nicht oder nur schlecht möglich: Schlaganfall, Morbus Parkinson, Drogen, Medikamente
• Bewegungen werden über längere Zeit pausenlos wiederholt: Erkrankungen des Nervensystems, Demenz
• Plötzliche unkontrollierte Bewegungen: Entstehung eines Krampfes, Schlaganfall
• Eingeschränkte oder nicht mögliche Bewegungen (Lähmungen): Verschleiß, verschiedene Erkrankungen von Gelenken und Wirbelsäule, eingeschränkte Beweglichkeit durch eine unnormale Gelenkstellung aufgrund einer längeren Ruhigstellung des Gelenkes
Gestik: Bewegung von Armen und Händen.
Sie erfolgt oft unwillkürlich, manchmal als unbewusste Abwehrreaktion, die nicht persönlich gemeint sein muss. Bei einer Einschränkung des Hörvermögens oder Gehörlosigkeit ist Gestik eine wichtige Möglichkeit der Kommunikation.
Steife, ungelenke Gestik: Folge von Schmerzen bei Bewegungen, Morbus Parkinson und ängstlicher Zurückhaltung.
Fähigkeit zur Selbstversorgung
• Alleinversorger
• Teilweise fremdversorgt
• Komplett fremdversorgt
Oft gibt uns die Stimme schon viele Informationen über den Zustand des Pflegeempfängers.
• Schwache und flüsternde Stimme: mögliches Anzeichen für Angst, Schmerzen, Müdigkeit/Erschöpfung, Unsicherheit oder eine Erkrankung im Rachenbereich
• Heisere, belegte Stimme: Entzündung oder Reizung (z. B. durch Qualm)
• Undeutliche Sprache: Zahn- oder Kieferveränderungen, Lähmungen im Gesichtsbereich, eine schlecht sitzende Zahnprothese
• Lallt der Pflegeempfänger, ist oft Alkohol, eine Erkrankung (z. B. Schlaganfall) oder ein Medikament die Ursache.
• Gewicht
• Normaler Ernährungszustand
• Kachexie: Fehlen der normalen Fettpolster, stark reduzierte Hautspannung, Auszehrung und Kräfteverfall
• Adipositas: Übergewicht
• Appetit: Wird alles gegessen, kleine oder große Portionen, oft oder selten, Vorlieben oder Abneigungen
• Nur geeichte Waagen verwenden, die waagerecht an immer der gleichen Stelle stehen
• Der Pflegeempfänger ist immer zur gleichen Tageszeit, am besten morgens und in ungefähr der gleichen Bekleidung zu wiegen.
• Gewogen wird bei der Aufnahme, bei Essstörungen oder starken Ödemen (Wassereinlagerungen) und nach der hausüblichen Routine.
• Veränderungen an Haut und Schleimhaut
2.3.4 Veränderungen im Gesicht
Alter, Krankheiten und die Erfahrungen, die jemand gemacht hat, prägen auch dessen Gesicht.
• Gerötet: Scham, Fieber, Anstrengung, hoher Blutdruck
• Blass: Schock, Unterkühlung, Blutarmut
• Gelb: Lebererkrankung
• Spitze Nase, tief liegende Augen mit dunklen Rändern und eingefallene, blasse Wangen: Schwere Erkrankung mit Fieber, Schock, naher Tod
• Schlaffe Gesichtshälfte und/oder eine hängende Lippe auf einer Gesichtshälfte: Schlaganfall mit einer Halbseitenlähmung
• Starrer Gesichtsausdruck mit fehlender oder stark eingeschränkter Mimik: evtl. Morbus Parkinson, »In-sich-Zurückgezogensein«
Beim gesunden, wachen Menschen sind beide Augen gleich weit geöffnet, der Augapfel ist prall gefüllt und glänzt feucht. Die Pupillen bewegen sich gleichzeitig, sind gleich groß und reagieren auf Licht.
• Gerötet: Weinen, Entzündung
• Gelb: Lebererkrankung
• Auge tritt zum Teil aus der Augenhöhle: Entzündungen, Morbus Basedow
Mimik/Bewegung der Gesichtsmuskulatur
Normalerweise passt der Mensch seine Mimik (s. u.) der jeweiligen Situation an.
Schmerzen, Unruhe, Trauer, Ängste, Teilnahmslosigkeit, aber auch Freude oder rege Teilnahme zeigen sich oft im Gesicht.
Krankheiten, die eine komplette oder teilweise Lähmung der Gesichtsmuskulatur hervorrufen, verhindern ein solches Mimikspiel. Das Gesicht des Pflegeempfängers wirkt dann oft fälschlicherweise hart oder unbewegt. Hier ist besonders große Aufmerksamkeit gefordert, da der Gesichtsausdruck oft das Erste ist, was wir von einem Menschen wahrnehmen und das uns einen ersten Eindruck vermittelt.
2.3.5 Psychische Verfassung
• Verhalten
− Gefühle wie Ängste, Gelassenheit, Kooperation, Ruhe/Unruhe
− Das Verhalten eines Pflegeempfängers hängt von seinen Stimmungen, seiner Vergangenheit, äußeren Faktoren wie der direkten Umgebung, der Stimmung der Pflegekraft, der sozialen Situation und vielem mehr ab.
• Bewusstseinslage
• Mimik (sichtbare Bewegungen der Gesichtsoberfläche)
• Gestik (Bewegungen insbesondere der Arme und Hände)
• Gang und Haltung
• Beweglichkeit
• Stimme, Sprache
Benommenheit:: Zeitweilige geistige Abwesenheit.
Ursachen: Übermüdung, Stress, Schwäche, Medikamente, Alkohol/Drogen.
Somnolenz: Schläfrige Teilnahmslosigkeit, die durch Reize nur kurz unterbrochen werden kann, geringe Merkfähigkeit, verlangsamtes Reaktions- und Erinnerungsvermögen.
Ursachen: starkes Schlafdefizit, Medikamente, Tumore, Unterkühlung, Drogen.
Sopor: Nur mit starken Reizen erweckbar; Öffnen der Augen, keine Antwort auf Fragen. Reflexe sind noch vorhanden.
Ursachen: Vergiftungen, Medikamente, Tumore, Drogen.
Koma:Bewusstlosigkeit, keinerlei Reflexe oder Schmerzreaktionen, unwillkürlicher Stuhl- und Wasserabgang.
Ursachen: mangelnde Hirndurchblutung, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Erkrankungen der Atmungsorgane (eventuell Aspiration: Verlegung der Luftwege durch einen Fremdkörper), Stoffwechselstörungen, Tumore, Drogen.
Rund ein Drittel unseres Daseins verbringen wir im Schlaf. Das Schlafbedürfnis eines Erwachsenen liegt etwa zwischen sechs und zehn Stunden. Die »optimale« tägliche Schlafdauer für den erwachsenen Menschen sowie deren Verteilung über den Tag ist wissenschaftlich umstritten.
Es gibt grundsätzlich zwei Schlaftypen:
• Den Früh-ins-Bett-Geher-und-Früh-Aufsteher
• Den Spät-ins-Bett-Geher-und-Spät-Aufsteher
Im Schlaf wechseln sich REM- und NREM-Phasen ab.
• NREM-Schlaf: Puls, Atemfrequenz, Blutdruck und Gehirnaktivität sinken ab
• REM-Schlaf: erhöhte Gehirnaktivität (an Träume aus dieser Phase erinnert man sich am häufigsten), Anstieg der Herz- und Atemfrequenz und des Blutdrucks. Die Muskulatur ist im REM-Schlaf blockiert.
Schlaf-wach-Rhythmus:
• Jeder Mensch hat eine »Innere Uhr«, nach der er wach ist und schläft.
Schlafmangel:
• Verlangsamt die Wundheilung
• Schädigt das Immunsystem
• Erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes
Einschlafstörungen
Symptome
Längere Phasen der ungewollten Wachheit in der Einschlafphase.
• Koffein später als am Nachmittag
• Sport oder Arbeit am späteren Abend
• Melatoninmangel
• Die beste Einschlaf-Zeit: bei beginnender Müdigkeit
• Die beste Schlafzimmertemperatur: zwischen 16 und 19 °C
• Dunkelheit erleichtert häufig das Einschlafen.
• Einschlafrituale können das Einschlafen fördern.
• Positive Gedanken erleichtern das Einschlafen.
• Kein Mittagsschlaf
Durchschlafstörungen
Symptome
• Frühzeitiges erstmaliges Erwachen
• Häufiges Kurzerwachen
• Längeres Wachliegen
• Unruhiger und oberflächlicher Schlaf
Читать дальше