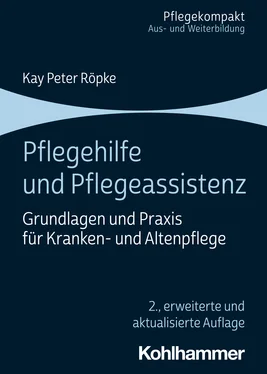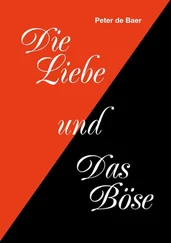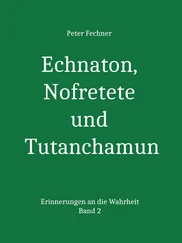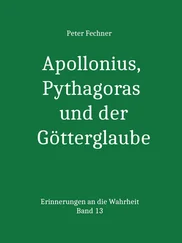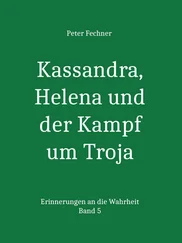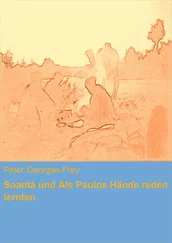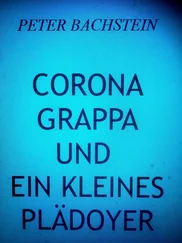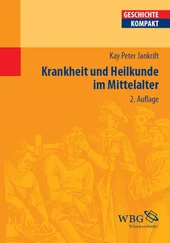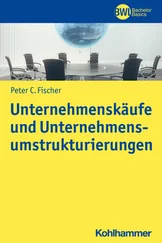Kay Peter Röpke - Pflegehilfe und Pflegeassistenz
Здесь есть возможность читать онлайн «Kay Peter Röpke - Pflegehilfe und Pflegeassistenz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Pflegehilfe und Pflegeassistenz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pflegehilfe und Pflegeassistenz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Pflegehilfe und Pflegeassistenz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Pflegehilfe und Pflegeassistenz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Pflegehilfe und Pflegeassistenz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
32 4 Störungen der Kommunikation 4 Störungen der Kommunikation Einführung Teile unseres Gehirns sind für die Wahrnehmung, das Sprachverständnis, die Wort- und Sprachbildung, das Denken in Wörtern und Sätzen und die Verwendung von Sprache beim Lesen und Schreiben zuständig. Bei Verletzungen oder krankhaften Veränderungen dieser Bereiche kommt es zu Einschränkungen des Sprachvermögens. Erkrankungen der Sprachorgane beeinflussen ebenfalls unser Sprachvermögen. Auch eine schlecht sitzende Prothese schränkt das Sprachvermögen ein.
33 4.1 Sprechvorgang 4.1 Sprechvorgang Organe des Sprechvorgangs: • Lunge • Stimmbänder • Der gesamte Mund-, Nasen- und Rachenraum mit Zunge, Gaumen, Gaumensegel • Lippen • Zähne • Unterkiefer • Ohren • Gehirn
34 4.2 Hören 4.2 Hören Schwerhörigkeit Schwerhörigkeit wird oft aus Scham verleugnet. Der Pflegeempfänger täuscht vor, alles zu verstehen, was die Kommunikation mitunter sehr erschwert. Ab dem 55. Lebensjahr verschlechtert sich das Hörvermögen bei vielen Menschen durch den normalen Altersabbau. Bei einer Einschränkung des Hörvermögens ist es wichtig, langsam und mit deutlichen Lippenbewegungen zu sprechen.
35 4.3 Hörgeräte 4.3 Hörgeräte Hörgeräte verstärken alle Schallwellen, so dass die Betroffenen wieder besser hören können. Verschiedene Hörgeräte machen dies unterschiedlich gut. Wichtig ist eine gute Beratung durch einen Akustiker. Ein- und Ausschalten: + oder 0. Bei Nichtgebrauch sollte man das Hörgerät ausschalten, um Strom zu sparen. Es gibt auch aufladbare Akkus. Lautstärke regulieren: Kleines Rad mit Zahlen Tonübertragung: M = Mikrofon ist eingeschaltet, normales Hören; T = Position für das Telefonieren und Höranlagen; MT = Beide Möglichkeiten.
36 4.4 Sehbehinderung 4.4 Sehbehinderung Einem Sehbehinderten fehlen zum vollständigen Verstehen die Mimik und Gestik des Gesprächspartners. Eine besonders deutliche Aussprache ist daher sehr wichtig. Sehbehinderte haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich über Neuigkeiten zu informieren; sie können z. B. ihre Post nicht mehr lesen. Stark Sehbehinderte können nicht mehr Auto oder Fahrrad fahren und sind dadurch weniger mobil. Sie können oft nicht mehr allein einkaufen, zur Bank, ins Kino, zum Essen oder ins Theater gehen. Ihnen fehlt die Möglichkeit, sich farblich passend anzuziehen und Bekannte und Freunde auf der Straße zu erkennen. So geraten sie schnell ungewollt ins soziale Abseits. Umgang mit sehbehinderten oder blinden Menschen: • Das Betreten oder Verlassen eines Zimmers immer ankündigen • Den Pflegeempfänger immer mit seinem Namen anreden und sich selbst vorstellen • Wege zu unbekannten Orten immer genau beschreiben und Hilfe anbieten, aber nicht aufdrängen • Im Zimmer eines sehbehinderten Pflegeempfängers nichts umstellen, ohne den Pflegeempfänger vorher darüber zu informieren • Nichts auf dem Boden stehen oder liegen lassen (Stolperfallen) • Türen nach Absprache immer oder zu festen Zeiten offen oder geschlossen lassen • Alle neuen Tätigkeiten und Vorgänge erklären • Ortsbeschreibungen und auch die Anordnung der Speisen auf einem Teller nach dem Uhrzeigerprinzip erklären: »Das Fleisch liegt auf 12 Uhr, die Kartoffeln auf 3 Uhr.« • Berührungen ankündigen, um ein Erschrecken zu vermeiden • Bei der Bitte um Führung den eigenen Arm anbieten, etwas vorausgehen und Hindernisse ankündigen
37 4.5 Umgang mit verwirrten Menschen 4.5 Umgang mit verwirrten Menschen In erster Linie ist darauf zu achten, dass die Verwirrtheit nicht gefördert oder verstärkt wird. Bringen sie auch für Verwirrte Respekt und Achtung auf. Verwirrte sind keine Kinder und möchten auch nicht so behandelt werden. Man sollte möglichst in einfachen Worten und kurzen Sätzen mit ihnen kommunizieren.
38 5 Gefühle und Emotionen im Pflegealltag 5 Gefühle und Emotionen im Pflegealltag 5.1 Ekel In der Pflege begegnen wir immer wieder Dingen oder Situationen, die Ekel hervorrufen. Ekel ist individuell und nicht diskutierbar. • Der Umgang mit ekeligen Situationen kann manchmal durch Schutzkleidung (Mundschutz/Handschuhe) vereinfacht werden. • Der Austausch mit Kollegen oder »Galgenhumor« können ebenfalls helfen, diese Situationen zu meistern. • Eine anschließende kurze Pause hilft, wieder Abstand zu gewinnen.
39 5.1 Ekel
40 5.2 Ängste 5.2 Ängste Pflegende Ängste vor Ansteckung, vor dem Sterben, davor, seinem Job nicht gerecht zu werden etc. gehören gerade zu Beginn zum Alltag. Sie dürfen nicht geleugnet werden, sondern müssen ernst genommen werden. Ängste sollten mit Kollegen des Vertrauens besprochen werden, um einen Weg zu finden, mit ihnen umzugehen. Häufig zeigt sich, dass andere ähnliche Ängste hatten oder haben, ein Austausch kann den Umgang häufig erleichtern.
41 5.3 Gewalt, Aggressionen 5.3 Gewalt, Aggressionen §Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 und 3) Gewalt ist all das, was den Menschen in seiner Individualität einschränkt und was ihn zwingt/zwingen soll, etwas gegen seinen Willen zu tun oder gegen seinen Willen zu unterlassen. Gewalt und Aggressionen entstehen oft aufgrund von Überforderung, Verunsicherung, mangelnder Anerkennung und dem Gefühl, allein gelassen zu werden. Gewalt kann sowohl durch Pflegekräfte als auch durch Angehörige oder Pflegeempfänger ausgeübt werden. Aggressionen werden nicht zwangsläufig aktiv ausgeübt, auch das Nichtbeachten oder offensichtliches Desinteresse sind eine Form der Gewalt. Gewalt und Aggression durch Pflegekräfte werden häufig aus falsch verstandener Kollegialität oder aus anderen Gründen totgeschwiegen. Beim Beobachten von Aggression oder Gewalt gegenüber Pflegeempfängern sollte nicht weggesehen werden, sondern das Thema direkt oder in einer Supervision angesprochen werden. Gewalt und Aggression haben immer Gründe, über die zunächst jeder für sich selbst nachdenken sollte, um sich zu fragen: »Was kann ich dagegen tun?« Niemand möchte, dass so etwas einem selbst oder nahestehenden Personen widerfährt. Aggressionen von Pflegeempfängern sind selten persönlich gemeint und sollten auch nicht so aufgefasst werden (Überforderung, Verunsicherung, mangelnde Anerkennung).
42 6 Sterben und Tod 6 Sterben und Tod Einführung Das Sterben und der Tod sind Themen, die jeden betreffen, über die sich aber nur wenige Gedanken machen. Erkrankungen oder Unfälle mit Todesfolge können jeden Menschen in jedem Alter treffen. Jede Sterbesituation und der Umgang damit ist auch bei vielen Ähnlichkeiten immer individuell. Häufig herrscht große Unsicherheit, wie mit dem Sterben umgegangen werden soll.
43 6.1 Sterbephasen nach Kübler-Ross 6.1 Sterbephasen nach Kübler-Ross 1. Phase: Nicht-wahrhaben-wollen und Isolierung Der Pflegeempfänger ist von seiner Diagnose geschockt und glaubt an Verwechslungen und Irrtümer. Dies kann in einen Zustand der Starre und Handlungsunfähigkeit führen. Angehörige, Pflegende und Ärzte haben oft Schwierigkeiten mit der Situation. Um den Pflegeempfänger zu »schonen«, aber auch um der eigenen Betroffenheit zu entgehen, versuchen Angehörige und Pflegende oft, die Todesnähe zu verbergen.
44 6.2 Patientenverfügung/Patientenvollmacht (Vorsorgevollmacht) 6.2 Patientenverfügung/Patientenvollmacht (Vorsorgevollmacht) Patientenverfügungen, in denen klar definiert ist, was ein Mensch im Fall, dass er sich selbst nicht mehr ausdrücken kann, wünscht oder nicht wünscht, sind eine große Hilfe für alle Beteiligten. Wichtig ist es, konkrete Angaben zu Behandlungsmaßnahmen zu machen. »Ich möchte keine unnötigen Schmerzen erleiden« ist keine Aussage, die weiterhilft. • Möchte ich auf jeden Fall, das alle lebensverlängernden Maßnahmen unternommen werden, oder möchte ich gar nicht reanimiert werden? • Möchte ich künstlich beatmet werden? • Kommt für mich eine Herzoperation in Frage? • Möchte ich bei einer unheilbaren Erkrankung weiterhin ernährt werden (auch über Schläuche)? • Möchte ich nach einem schweren Hirnschaden mit wenig Aussicht auf eine Besserung weiter maximal behandelt werden? Diese und andere Fragen sollten mit einer Person des Vertrauens oder dem Arzt des Vertrauens besprochen werden. Wichtig ist es, eine Person zu bestimmen, welche die eigenen Interessen konsequent durchsetzt. Vorschläge für Patientenverfügungen gibt es viele im Internet. Wichtig ist, dass in den vorgefertigten Formularen möglichst genau die Wünsche und Vorstellungen der betroffenen Person dargestellt werden und die Möglichkeit von eigenen Kommentaren besteht. Eine notarielle Beglaubigung ist NICHT nötig. Das Vorhandensein einer Patientenverfügung oder einer Patientenvollmacht (s. u.) sollte auf einer kleinen Karte im Portemonnaie vermerkt sein. Die Patientenverfügung sollte jedes Jahr neu unterschrieben werden. Änderungen sind durch die betroffene Person jederzeit möglich, auch bei einem plötzlichen Sinneswandel. Wann ist eine Patientenverfügung wirksam? • Die Verfügung muss schriftlich und vom Aussteller eigenhändig unterschrieben sein • Der Verfasser muss volljährig und einwilligungsfähig sein • Eine Beglaubigung der Unterschrift oder notarielle Beurkundung der Patientenverfügung ist nicht nötig • Hilfreich ist es, wenn weitere Personen den Willen des Verfassers mit ihrer Unterschrift auf der Verfügung bezeugen.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Pflegehilfe und Pflegeassistenz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Pflegehilfe und Pflegeassistenz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Pflegehilfe und Pflegeassistenz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.