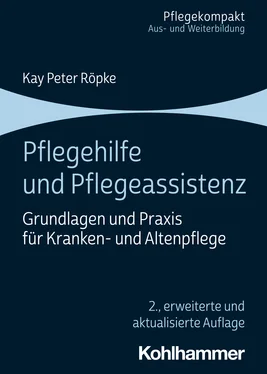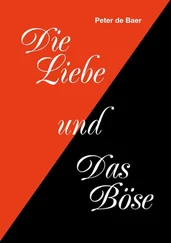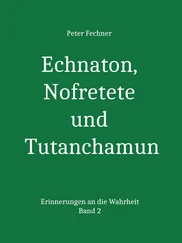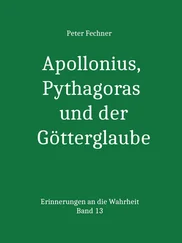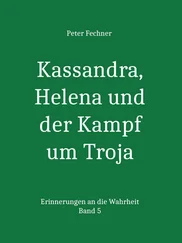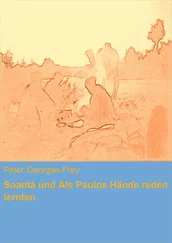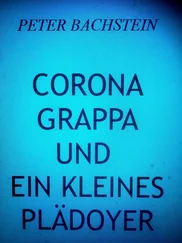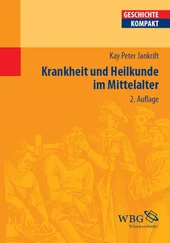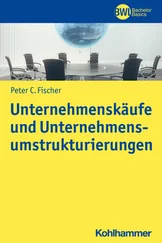Stark Sehbehinderte können nicht mehr Auto oder Fahrrad fahren und sind dadurch weniger mobil. Sie können oft nicht mehr allein einkaufen, zur Bank, ins Kino, zum Essen oder ins Theater gehen. Ihnen fehlt die Möglichkeit, sich farblich passend anzuziehen und Bekannte und Freunde auf der Straße zu erkennen. So geraten sie schnell ungewollt ins soziale Abseits.
Umgang mit sehbehinderten oder blinden Menschen:
• Das Betreten oder Verlassen eines Zimmers immer ankündigen
• Den Pflegeempfänger immer mit seinem Namen anreden und sich selbst vorstellen
• Wege zu unbekannten Orten immer genau beschreiben und Hilfe anbieten, aber nicht aufdrängen
• Im Zimmer eines sehbehinderten Pflegeempfängers nichts umstellen, ohne den Pflegeempfänger vorher darüber zu informieren
• Nichts auf dem Boden stehen oder liegen lassen (Stolperfallen)
• Türen nach Absprache immer oder zu festen Zeiten offen oder geschlossen lassen
• Alle neuen Tätigkeiten und Vorgänge erklären
• Ortsbeschreibungen und auch die Anordnung der Speisen auf einem Teller nach dem Uhrzeigerprinzip erklären: »Das Fleisch liegt auf 12 Uhr, die Kartoffeln auf 3 Uhr.«
• Berührungen ankündigen, um ein Erschrecken zu vermeiden
• Bei der Bitte um Führung den eigenen Arm anbieten, etwas vorausgehen und Hindernisse ankündigen
4.5 Umgang mit verwirrten Menschen
In erster Linie ist darauf zu achten, dass die Verwirrtheit nicht gefördert oder verstärkt wird. Bringen sie auch für Verwirrte Respekt und Achtung auf.
Verwirrte sind keine Kinder und möchten auch nicht so behandelt werden. Man sollte möglichst in einfachen Worten und kurzen Sätzen mit ihnen kommunizieren.
5 Gefühle und Emotionen im Pflegealltag
5.1 Ekel
In der Pflege begegnen wir immer wieder Dingen oder Situationen, die Ekel hervorrufen. Ekel ist individuell und nicht diskutierbar.
• Der Umgang mit ekeligen Situationen kann manchmal durch Schutzkleidung (Mundschutz/Handschuhe) vereinfacht werden.
• Der Austausch mit Kollegen oder »Galgenhumor« können ebenfalls helfen, diese Situationen zu meistern.
• Eine anschließende kurze Pause hilft, wieder Abstand zu gewinnen.
Ängste vor Ansteckung, vor dem Sterben, davor, seinem Job nicht gerecht zu werden etc. gehören gerade zu Beginn zum Alltag. Sie dürfen nicht geleugnet werden, sondern müssen ernst genommen werden.
Ängste sollten mit Kollegen des Vertrauens besprochen werden, um einen Weg zu finden, mit ihnen umzugehen. Häufig zeigt sich, dass andere ähnliche Ängste hatten oder haben, ein Austausch kann den Umgang häufig erleichtern.
Ängste vor dem weiteren Verlauf einer Krankheit, Sorge um die Zukunft von Angehörigen, die Angst, Dinge nicht mehr erleben zu können – es gibt viele Ängste, die Pflegeempfänger haben können.
Ängste sind immer ernst zu nehmen und nicht etwa abzuschwächen. Es sollte immer ehrlich über die Erkrankung gesprochen werden und keine falschen Hoffnungen geweckt werden.
§Die Würde des Menschen ist unantastbar.
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 und 3)

Gewalt ist all das, was den Menschen in seiner Individualität einschränkt und was ihn zwingt/zwingen soll, etwas gegen seinen Willen zu tun oder gegen seinen Willen zu unterlassen.
Gewalt und Aggressionen entstehen oft aufgrund von Überforderung, Verunsicherung, mangelnder Anerkennung und dem Gefühl, allein gelassen zu werden.
Gewalt kann sowohl durch Pflegekräfte als auch durch Angehörige oder Pflegeempfänger ausgeübt werden.
Aggressionen werden nicht zwangsläufig aktiv ausgeübt, auch das Nichtbeachten oder offensichtliches Desinteresse sind eine Form der Gewalt.
Gewalt und Aggression durch Pflegekräfte werden häufig aus falsch verstandener Kollegialität oder aus anderen Gründen totgeschwiegen. Beim Beobachten von Aggression oder Gewalt gegenüber Pflegeempfängern sollte nicht weggesehen werden, sondern das Thema direkt oder in einer Supervision angesprochen werden.
Gewalt und Aggression haben immer Gründe, über die zunächst jeder für sich selbst nachdenken sollte, um sich zu fragen: »Was kann ich dagegen tun?«
Niemand möchte, dass so etwas einem selbst oder nahestehenden Personen widerfährt.
Aggressionen von Pflegeempfängern sind selten persönlich gemeint und sollten auch nicht so aufgefasst werden (Überforderung, Verunsicherung, mangelnde Anerkennung).
Macht: etwas durchsetzen können
Ohnmacht: Unfähigkeit zu handeln
Empathie: Bereitschaft und Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle, Motive und Persönlichkeit einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen
Beispiel zu Macht und Empathie
Herr Müller soll aus dem Bett aufstehen, er möchte aber liegen bleiben. Mit Macht: »Herr Müller, sie müssen aber jetzt aufstehen!« Mit Empathie: »Geht es Ihnen heute Morgen nicht so gut?«
Um Herrn Müller doch zum Aufstehen zu bewegen, könnten wir versuchen,
• Ihn zu überzeugen (leckeres Frühstück etc.)
• Ihn zu überreden (»Tun Sie es für mich«)
• Ihn zu manipulieren (»Sie sind doch ein Frühaufsteher«)
Formen von Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen
Respektloses Verhalten
• ohne Anzuklopfen ein Zimmer betreten
• Vermeiden von Blickkontakten
• Pflegeempfänger wie ein Kind ansprechen oder behandeln
• Pflegeempfänger beleidigen, bloßstellen oder abfällige Bemerkungen machen
• Ansprache ohne Blickkontakt
• Schläge, kneifen, an den Haaren ziehen
• Nicht angepasste Unterstützung, zu schnell oder zu grob
• Unbequemes Hinsetzen/-legen
• Wäsche mit zu heißem oder kaltem Wasser
• nicht einfühlsamer Verbandswechsel
• Ignorieren von Bedürfnissen, Gefühlen oder Schmerzen
• Unnötig lange auf Hilfe warten lassen
• Unzureichende Unterstützung/Verweigerung, etwa beim Aufstehen, Gehen, Körperpflege
• Ignorierung/Verweigerung von Wechsel schmutziger Kleidung
• Einschließen in Räumen
• Fixierung
• Bettgitter oder ähnliche Aufsteheinschränkungen
• Gabe von medizinisch nicht notwendigen/verordneten Medikamenten zur Ruhigstellung
• Vorenthalten von Hilfsmitteln wie Klingel, Brille, Prothese, Gehstock
• Vorenthalten von Informationen (wichtige Neuigkeiten, Post)
• Tagesablauf, Beschäftigung, Kontakte, Ausgaben ohne Grund bestimmen/einschränken
• »Füttern«, damit es schneller geht
• Ungefragtes Lesen/Öffnen von Briefen
• Pflegemaßnahmen gegen den Willen durchführen, z. B. Verwendung von Inkontinenzmitteln, um Toilettengang zu vermeiden
6 Sterben und Tod
Einführung
Das Sterben und der Tod sind Themen, die jeden betreffen, über die sich aber nur wenige Gedanken machen. Erkrankungen oder Unfälle mit Todesfolge können jeden Menschen in jedem Alter treffen. Jede Sterbesituation und der Umgang damit ist auch bei vielen Ähnlichkeiten immer individuell. Häufig herrscht große Unsicherheit, wie mit dem Sterben umgegangen werden soll.
Sterben ist ein Prozess, der sich oft über Tage, manchmal Wochen oder länger hinzieht.
Читать дальше