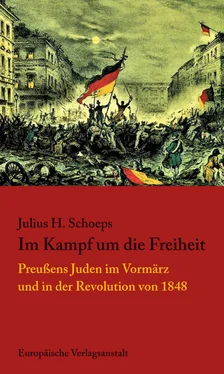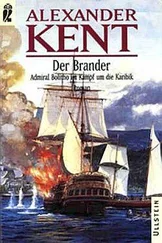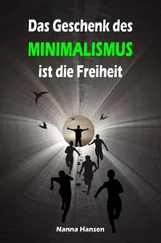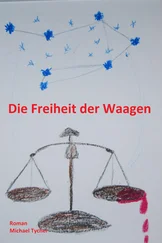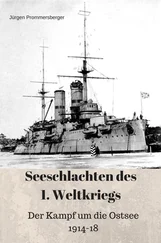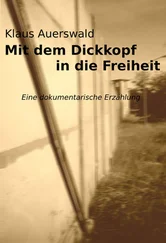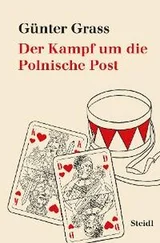Der Streit um den Zeitpunkt der jüdischen Bestattung drehte sich vordergründig um die Frage des Scheintodes und die Gefahr, dass jemand womöglich lebendig begraben werden könnte. Gleichwohl war es nicht nur ein Streit in der Sache, sondern ein Streit zwischen Traditionalisten und Aufklärern, wobei die Ersteren aus nicht nachvollziehbaren Gründen zäh an dem Brauch der Frühbeerdigung festhielten. Salomon Seligmann Pappenheimer etwa, Rabbiner in Breslau, zog sich Kritik und Spott der aufgeklärten Kreise insbesondere dadurch zu, dass er in einer Anzahl von Schriften vehement dafür plädierte, den Brauch der Frühbestattung nicht aufzugeben.
Im Verlauf der Jahre entwickelte sich die „Gesellschaft der Freunde“ zunehmend zu einer karitativen Vereinigung. Vereinzelt wurden auch christliche Mitglieder aufgenommen, allerdings blieb ihr Anteil an der Gesamtmitgliederzahl verschwindend gering. In den Augen traditionell eingestellter Juden blieb diese Vereinigung jedoch eine Gesellschaft von Neuerern. Das Misstrauen war groß und insofern durchaus zutreffend, als die „Gesellschaft“ sich zunächst als ein Bund junger Juden konstituiert hatte, dessen Mitglieder zwar an ihren Familientraditionen und an ihrem Glauben festhielten, aber gleichzeitig auch die „Fesseln nationaler Absonderung […] von ihrem eigenen Denken und Thun“ 15abschütteln wollten.
Die „Gesellschaft der Freunde“ entwickelte sich nun zu einer Art Kulturzentrum, in der Gleichgesinnte verkehrten, um sich zu treffen und um in vertrauter Runde sich miteinander auszutauschen. Anfänglich war es der jüdische Charakter, der die „Gesellschaft“ prägte. Das war ein Sachverhalt, der sich im Verlauf der Zeit jedoch allmählich änderte. Je mehr ihre Mitglieder in die nichtjüdische Welt „eintauchten“, je mehr sie sich mit Berlin, Preußen und Deutschland identifizierten, desto mehr begann man in der „Gesellschaft“, die religiöse Zugehörigkeit als Privatangelegenheit zu betrachten.
Sieht man sich die Mitgliederlisten der „Gesellschaft“ an, so zeigt sich, dass in diesen die Namen bekannter Familien wie die Mendelssohns, die Veits, die Liebermanns, die Friedländers, die Bleichröders, aber auch die Rathenaus prominent verzeichnet sind – Familien, die die Berliner Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik im 19. und frühen 20. Jahrhundert in starkem Maße geprägt haben. Der Historiker Sebastian Panwitz hat ermittelt, dass mehr als 2.300 Personen Mitglieder der „Gesellschaft“ waren. Die in der von Panwitz zusammengestellten Liste aufgeführten Namen lesen sich geradezu wie ein „Who is who“ der Berliner „besseren“ jüdischen Gesellschaft jener Jahre.
Die „Gesellschaft der Freunde“ hat bis in die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts existiert, bevor sie von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Sie galt als „jüdische Gesellschaft“, obgleich das Judentum und die konfessionelle Zugehörigkeit in der Spätzeit bei den Mitgliedern kaum noch eine Rolle spielten. Man bekannte sich zwar zur einstigen jüdischen Herkunft der „Gesellschaft“, sah das aber nicht als Makel, sondern eher als eine Auszeichnung an.
David Friedländer, ein Vordenker der Emanzipation
Eine Öffnung gegenüber der christlichen Umgebungsgesellschaft, wie sie der Mendelssohn-Schüler, Seidenwarenhändler und Publizist David Friedländer (1750–1834) 16und andere jüdische Notablen forderten, wurde allerdings mit einer schmerzlichen Gegenforderung gekontert: Von den Juden wurde seitens des Königs und seiner Behörden erwartet, dass sie sich im Zuge einer bürgerlichen Gleichstellung von ihren „überkommenen Traditionen und Bräuchen“ lösen würden. An anderer Stelle wird darüber noch ausführlich zu berichten sein.
Das Sich-Öffnen gegenüber der christlichen Umgebungsgesellschaft hatte für viele Juden tatsächlich schwer absehbare Konsequenzen. Zunächst kam es zu einer deutlich steigenden Konversionsrate zum Christentum, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen preußischen Städten wie Breslau und Königsberg. Die Übertritte waren um 1800 unverhältnismäßig hoch. Dass immer mehr „Hausväter“ sich vom Judentum abwendeten, so klagte Friedländer, sei ein Sachverhalt, der unbedingt zur Kenntnis genommen werden müsse, wolle man verstehen, was das für die Juden bedeute.
Wie sehr David Friedländer, der selbst ein erfolgreicher Kaufmann und Unternehmer war, das Problem des Übertritts von Juden zum Christentum bewegte, wird deutlich in einem seiner Schreiben, die er an Karl August von Hardenberg richtete. In diesem war eine Liste mit etwa 50 Familien aufgeführt, die Angehörige durch die Taufe „verloren hatten“. Ausdrücklich erwähnt werden u.a. die Namen der Berliner Familien Itzig, Lewy, Flies, Ephraim, Magnus und Mendelssohn. 17
Die Taufe, so gab Friedländer zu bedenken, beraube die Gemeinde ihrer besten und klügsten Köpfe. Dabei dachte er wohl auch an seine eigene Familie. Seine Schwiegertochter Rebecca hatte sich von seinem Sohn Moses scheiden lassen und ebenfalls den Gang zum Taufbecken gewählt. Der Staat, so meinte Friedländer seinerseits, müsste ein gesteigertes Interesse daran haben, dass die Juden im Judentum verblieben. Nur dann sei gewährleistet, dass ausreichend Steuern und Abgaben in die Kassen des Staates fließen würden.
Das Urteil über den Einfluss Friedländers bei den Beratungen, die im Vorfeld des Emanzipationsediktes von 1812 stattfanden, fällt bei den Historikern unterschiedlich aus. Die einen sehen in ihm einen Opportunisten, dem sie unterstellen, er hätte sich äußerst angepasst verhalten und eigentlich nichts wesentlich anderes im Sinn gehabt, als sich bei den tonangebenden Kreisen einzuschmeicheln.
Dieser Einschätzung haben im Rückblick manche Historiker allerdings deutlich widersprochen. Sie argumentieren ihrerseits, gerade das Beispiel Friedländer zeige, dass „er nicht bloß ein egoistischer Sprecher für seine Klasse war“, sondern dass er sich für das „Wohlergehen“ seiner Glaubensbrüder im Rahmen seiner damaligen Möglichkeiten eingesetzt habe. 18
Doch wie auch immer man zu David Friedländer und seinen emanzipationspolitischen Bemühungen stehen mag: Zu seinen Gunsten spricht im Rückblick, dass seine Interventionen offensichtlich mit dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zum Erlass eines Emanzipationsediktes kam. 19Ohne ihn hätte es vermutlich das Edikt von 1812 nicht gegeben, jedenfalls nicht in der Form, wie es dann erlassen wurde. Friedländer fertigte zahlreiche Gutachten an und war bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten auf den Gang der Gesetzgebungsarbeiten Einfluss zu nehmen.
David Friedländer und seine Mitstreiter mussten allerdings immer wieder bei den Behörden antichambrieren, bis es ihnen gelang, ihr Anliegen an zuständiger Stelle vorzutragen. Erst als Karl August von Hardenberg 1810 in das Amt des Staatskanzlers berufen wurde, kam Bewegung in die Angelegenheit. Die Vorarbeiten für den Erlass einer fortschrittlicher gefassten Judenordnung traten in ein entscheidendes Stadium.
Auf jüdischer Seite war man der Hoffnung, dass es mit einer überarbeiteten Judenordnung zu einer deutlichen Verbesserung der rechtlichen und sozialen Lage der Juden kommen würde. Mit Hardenberg verband sich die Erwartung, hier hätte jemand die Verantwortung übernommen, der bereit sei, nicht nur zu reden, sondern auch politisch zu handeln.
„Der Jude“, so David Friedländer in einer seiner zahlreichen Eingaben und Stellungnahmen, die er bei den Behörden einreichte, „ist Mensch und Staatsbürger so gut wie jeder andere und in seinen Religionsbegriffen ist durchaus nichts, was seine Glaubwürdigkeit mehr zweifelhaft machen sollte, als die des Christen“. Empört widersprach Friedländer der nach wie vor in der christlichen Umgebungsgesellschaft weit verbreiteten Auffassung, eine Aufhebung der bis zu dieser Zeit geltenden Eidesbeschränkung würde eine Gefahr für die allgemeine Sicherheit bedeuten. Wenn, so Friedländer, in dem neuen Gesetz nur der leiseste Verdacht zum Ausdruck käme, der Staat halte die Juden im Allgemeinen für lasterhafter als die übrigen Untertanen, so hätte die Reform eigentlich keinen Sinn.
Читать дальше