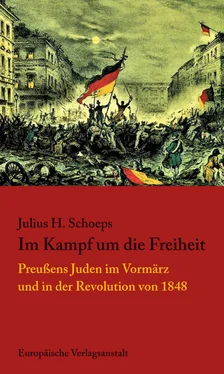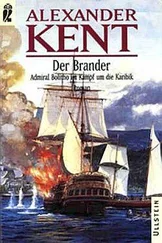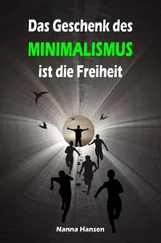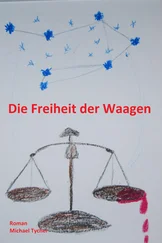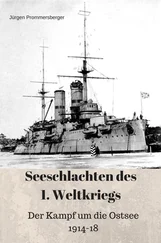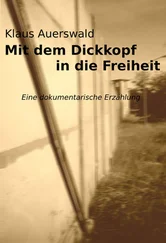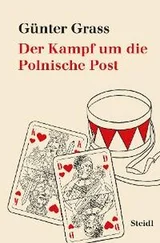Die Beteiligung an den Freiheitskriegen gegen die napoleonische Besatzung sah man gewissermaßen als Prüfstein für die Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten an. Je mehr Juden sich zu den Waffen meldeten, meinte man, desto nachdrücklicher würde sich zeigen, dass die Juden keine „Drückeberger“, sondern Patrioten seien, die den Dienst für das Vaterland tatsächlich als eine Ehrenpflicht betrachteten. Die patriotische Euphorie schlug derartige Wellen, dass sogar Frauen ins Feld zogen. Überliefert ist die Geschichte der Jüdin Louise Grafemus, die eigentlich Esther Manuel hieß und als Mann verkleidet die Feldzüge von 1813 und 1814 im Königsberger 2. Landwehr-Ulanen-Regiment mitmachte. 36
Wir wissen nicht, wie viele jüdische Soldaten tatsächlich an den Befreiungskriegen teilgenommen haben. Die Statistiken, die darüber und über die Zahl der Gefallenen Auskunft geben könnten, sind mit einiger Vorsicht zu genießen. Fest steht nur, dass das zahlenmäßig kleine jüdische Kontingent innerhalb der preußischen Truppen in relativ hohem Maße bei Beförderungen und Auszeichnungen vertreten war.
Der Historiker Heinrich von Treitschke, bekanntlich kein Freund der Juden, hat in seiner „Deutschen Geschichte“ ausdrücklich positiv vermerkt, dass Juden an den Feldzügen in den Befreiungskriegen teilgenommen haben: „Die Söhne jener gebildeten Häuser, die sich schon ganz als Deutsche fühlten, thaten ehrenhaft ihre Soldatenpflicht […].“ 37
Die militärischen Leistungen jüdischer Kriegsteilnehmer wurden als vorbildlich eingeschätzt. Was schon in den Befreiungskriegen deutlich wurde, zeigte sich auch in späteren Kriegen. Der Patriotismus der Juden unterschied sich nur wenig von der Einstellung nichtjüdischer Kriegsteilnehmer. So haben im preußisch-österreichischen Krieg 1866 auf preußischer Seite geschätzt über 1.000 jüdische Soldaten teilgenommen und im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 sind im deutschen Heer sogar 6.000 jüdische Soldaten ins Feld gezogen. 38
Als Höhepunkt des patriotischen Bekenntnisses deutscher Juden gilt ein halbes Jahrhundert später die Teilnahme von rund 100.000 jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. 39Von ihnen sind in diesem nachgewiesenermaßen 12.000 gefallen. Etwa 2.000 wurden zu Offizieren befördert; über 2.000 erhielten das Eiserne Kreuz 1. Klasse, 10.000 das Eiserne Kreuz 2. Klasse; insgesamt wurden 30.000 deutsche Juden mit Orden ausgezeichnet.
Aber zurück zu den Befreiungskriegen und der weiteren Entwicklung. Nur in Ausnahmefällen war es damals für einen Juden möglich, im preußischen Militär Karriere zu machen und die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Berühmt wurde der Fall des Berliner Juden Meno Burg, den man in späteren Jahren halbspöttisch den „Judenmajor“ nannte.
Meno Burg (1787–1853), ein Freiwilliger des Jahres 1813, war durch eine Kabinettsordre 1815 zum Sekondeleutnant befördert worden. Als man ihm aber nahelegte, die Taufe zu nehmen, damit er weiter Karriere machen und in höhere Offiziersränge aufsteigen könne, hat er diesen Schritt für sich entschieden abgelehnt. 40Burg, der sich sein Leben lang uneingeschränkt zu König und Vaterland bekannte, hätte die Taufe, wie er offen bekannte, als Verrat am Judentum empfunden.
Der an den Tag gelegte Patriotismus von Männern wie Meno Burg hat nicht nur in der Literatur, sondern auch in der zeitgenössischen Malerei einen erkennbaren Niederschlag gefunden. So war beispielsweise das in den Jahren 1833/34 entstandene Ölgemälde „Die Heimkehr des Freiwilligen aus dem Befreiungskriege zu den nach alter Sitte lebenden Seinen“ des Malers Moritz Daniel Oppenheim bemüht, den vaterländischsoldatischen Einsatz der Juden in Deutschland bildlich sichtbar zu machen.
Das in seiner Anlage biedermeierlich-betulich anmutende Bild, das Gabriel Riesser einst von den badischen Juden zum Geschenk gemacht worden war, gilt als eine der Ikonen der deutsch-jüdischen Gemäldekunst des 19. Jahrhunderts. Das Bild zeigt eine jüdische Familie, im Mittelpunkt der Freiwillige, in Uniform gekleidet, ein Eisernes Kreuz am Hals, in erschöpfter Pose halb sitzend, halb liegend. 41Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der Sohn ohne Kopfbedeckung am gedeckten Tisch sitzt, auf dem man einen Kiddusch-Becher und ein geflochtenes Brot (Challah) erkennt.
Zu erkennen ist darüber hinaus eine von der Decke herabhängende Sabbat-Lampe und die Vossische Zeitung unter einem Talmudband auf dem Tisch. Rechts auf dem Regal liegt ein Feststrauss (Lulaw), der im Morgengottesdienst des Laubhüttenfestes üblich ist.
Dem Werk „Heimkehr des Freiwilligen“ misst man wegen der Kombination der dort feststellbaren Bildmotive einen hohen Symbolgehalt bei. Blättert man in Bild-Text-Bänden zur deutsch-jüdischen Geschichte, dann fällt auf, dass man bis heute mit Vorliebe die Trias Oppenheimsches Gemälde, das Porträt von Meno Burg und ein solches von Gabriel Riesser oder von Ludwig Philippson zur Bebilderung der Thematik „Patriotismus“ miteinander vereint.
Der Wiener Kongress, der Sieg der Restauration und die wiedereinsetzende Diskriminierung der Juden
Nach dem Sieg der Koalitionsmächte über das napoleonische Frankreich und nach der Auflösung des Rheinbundes gerieten in Preußen die Reformen wieder ins Stocken. Auch die Bemühungen um die Judenemanzipation kamen mehr oder weniger zum Stillstand. Unabhängig vom Wiener Kongress und dem 1815 entstandenen Deutschen Bund, dem fast 40 Staaten und freie Städte angehörten, hielt man in einigen Herrschaftsgebieten an dem zuvor geschaffenen Stand der Emanzipationsgesetzgebung fest. Doch in anderen war man bemüht, das Rad wieder zurückzudrehen und die den Juden gewährten Staatsbürgerrechte erneut einzuschränken.
Insgesamt gab es 21 oder 22 verschiedene Reglements bzw. Gesetzesverordnungen für die Juden. Es können sogar 31 Judenordnungen gewesen sein, wenn man kleine und kleinste Gebiete berücksichtigt, die Preußen zugeschlagen worden waren und die ebenfalls spezifische Regelungen für die jüdischen Untertanen verabschiedet hatten. Bestand hatte das Edikt von 1812 in seiner ursprünglichen Fassung nur für die Provinzen Brandenburg, Pommern, Ostpreußen und Schlesien.
Am kompliziertesten, weil am widersprüchlichsten, war die Entwicklung in Preußen, das sich durch die Neuordnung des Kontinents ab 1815/16 um rund vierzig Prozent auf 278.000 Quadratkilometer vergrößert hatte. Statt 4,5 Millionen zählte Preußens Bevölkerung jetzt über 10,3 Millionen Menschen. Diese Entwicklung führte dazu, dass ein ganzes Konglomerat von Landesteilen mit unterschiedlichen Verfassungs– und Verwaltungsvorschriften existierte. Für die jüdische Bevölkerung war die Gesetzeslage kaum noch zu überblicken.
In den neu hinzugekommenen westfälischen, rheinischen und polnischen Gebieten kam das Edikt von 1812 nicht zur Anwendung. In den Landesteilen, die unter französischem Einfluss gestanden hatten, kam es zur Wiederherstellung der vor der Franzosenzeit geltende Rechtslage, was besagte, dass in den verschiedenen Landesteilen Preußens ab 1815/16 unterschiedlichste Vorschriften und Gesetze für die Juden Geltung besaßen.
Bald wurde vielerorts eine im Zuge der einsetzenden Reaktion um sich greifende Reformmüdigkeit und Emanzipationsunwilligkeit spürbar. Unklar formulierte Passagen des Emanzipationsediktes führten im Übrigen dazu, dass die Fachministerien und Verwaltungsbehörden diese geschickt nutzten, um die angekündigte und versprochene Gleichstellung zu hintertreiben.
Die zugestandene Übernahme bzw. das „Verwalten“, wie es damals genannt wurde, von staatlichen und kommunalen Ämtern wurde beispielsweise als unverbindlicher Auftrag ausgelegt. Besonders das Versprechen des Königs, Juden, die in den Befreiungskriegen als Soldaten gedient hatten, im Staatsdienst einzustellen, wurde nicht eingehalten. Juden, so argumentierte man erneut, seien für den Staatsdienst nicht geeignet.
Читать дальше