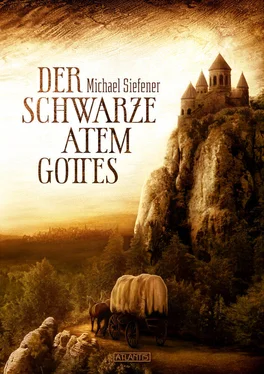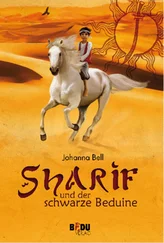Als Bruder Martin etwa zehn Minuten lang gegangen und das brennende Wirtshaus bereits hinter einer Wegbiegung verschwunden war und nur noch der Widerschein der Flammen hinter den schwarzen Bäumen hervorloderte und einen zuckenden, schwachen Schein auf den Weg warf, bogen die zahlreichen Hufspuren plötzlich nach links ab – mitten in den Wald hinein, der hier bereits an beiden Seiten nah an den breiten, staubigen Weg herangeschlichen war. Martin blieb stehen und versuchte, in den dichten Wald hineinzuspähen.
Es war kaum etwas zu sehen. Schon wenige Ellen jenseits des Weges verschwammen die großen Buchen und Tannen zu einer einförmigen schwarzen Masse, die schier undurchdringlich erschien. Sollten die Entführer tatsächlich an dieser Stelle in den finsteren Wald hineingeritten sein? Martin würde sich dort drinnen heillos verirren, von den zahlreichen natürlichen und übernatürlichen Gefahren eines derartigen Ortes ganz zu schweigen. Sollte er nicht besser zum Kloster zurückkehren und von dort Hilfe holen? Es lag noch etwa einen Tagesritt entfernt. Einen Tagesritt … aber er hatte kein Pferd. Zu Fuß würde es mindestens zwei Tage dauern, vielleicht sogar drei, bis er die rettenden Klostermauern erreicht hatte. Wäre es dann nicht bereits viel zu spät, um Pater Hilarius zu helfen? Vielleicht war Hilarius dann schon längst tot.
Was wollten diese Verbrecher überhaupt von einem mittellosen Mönch? Er konnte ihnen kein Geld geben, keine Edelsteine, nur seinen Gaul. Ob sie mit ihm vielleicht Lösegeld erpressen wollten? Aber würde das Kloster tatsächlich für ihn bezahlen? Martin bezweifelte es; Abt Odilo liebte es nicht, etwas weggeben zu müssen; er würde lieber auf einen Mitbruder als auf die Reichtümer des Klosters verzichten, auch wenn es sich um einen im Ruche der Heiligkeit Stehenden handelte. Wahrscheinlich wäre er der Meinung, dass Pater Hilarius sich vermittelst seiner Heiligmäßigkeit selbst befreien konnte. Wenn nicht, hätte das Kloster sogar einen Märtyrer. Martin konnte sich lebhaft vorstellen, wie der Abt sagen würde: »Gott hat es so gewollt, meine lieben Mitbrüder, und wir sollten ihm für seine unendliche Weisheit dankbar sein. Wenn er gewollt hätte, dass wir unseren Klosterschatz für Pater Hilarius eintauschen, so hätte er uns in seiner unendlichen Milde ein Zeichen gegeben; leider aber ist mir keines zugegangen.«
Martin spürte, wie sein Groll gegen den Abt, den er noch nie hatte leiden können, immer stärker wurde. War es wirklich sinnvoll, zum Kloster zurückzugehen? Pater Hilarius wurde zwar von vielen verehrt, doch seine asketische Strenge und sein gewaltiger Ruf war etlichen seiner Mitbrüder ein Dorn im Auge. Würden sie ihm überhaupt helfen wollen?
Bruder Martin fühlte sich, als zerrten ihn Engel und Dämonen in verschiedene Richtungen. Waren es die Dämonen, die ihn in die Sicherheit seines Klosters scheuchen wollten, oder waren es die Engel? Er horchte in sich hinein und wusste es nicht.
Über ihm stand nun das Beulengesicht des Mondes, der sein silbriges Licht hinunter auf die Landstraße warf. Sterne waren an den höchsten Spitzen der Tannen und Buchen aufgespießt. Die Unendlichkeit des Himmels dazwischen war samtblau, wie ein Versprechen von Gottesnähe. Der Weg lag fahl vor ihm – der Weg zum Kloster, fort von der Finsternis und dem unheimlichen Wald. Martin machte einen zögernden Schritt, dann noch einen – die Straße hinunter, auf seine Heimat zu. Je mehr Schritte er machte, desto schneller ging er. Jetzt, da er sich entschieden hatte, ging es ihm besser. Was konnte er als Einzelner, als schmächtiger Mönch schon gegen eine Räuberbande ausrichten? Er würde sein Leben nur sinnlos wegwerfen, und nichts wäre dabei gewonnen.
Aber tief in seinem Inneren hörte er die giftige, mahnende Stimme des Paters Hilarius.
Martin nahm sich fest vor, bei seinem Abt um die Errettung des Paters zu bitten und alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit Hilarius aus den Klauen der Verbrecher befreit wurde. Immer schneller, immer befreiter schritt er aus. Er freute sich bereits auf ein warmes Essen, auf ein anheimelndes Feuer, auf seine Mitbrüder, auf die Ruhe seines Klosters.
Da sah er in einiger Entfernung vor sich auf der Landstraße einen seltsamen Schemen. Verwirrt hielt er inne. Der Schemen blieb ebenfalls stehen. War es ein Wanderer? Jetzt, mitten in der Nacht? Kaum möglich. Martin glaubte, klagende Laute zu hören; sie kamen von dem schwarzen Umriss, der sich nun recht rasch auf den Mönch zubewegte.
Martin zauderte. Sollte er an diesem Umriss vorbeigehen? Würde er unbehelligt bleiben? Was war das für eine Gestalt? Der Mönch warf einen schnellen Blick über die Schulter. Der Rückweg war frei. Er drehte sich um und lief los. Weit hinten konnte er den rötlich-gelben Widerschein der Flammen erkennen.
Und vor ihm malte sich nun ein zweiter Umriss mitten auf der Straße ab, der aus dem Nichts gekommen zu sein schien oder aus dem finsteren Wald zuseiten des Weges. Der Rückweg war dem Mönch abgeschnitten.
Fieberhaft sah sich Martin um. Er befand sich jetzt etwa an der Stelle, wo die Entführer die Landstraße verlassen hatten und in den Wald geprescht waren. Sollte er wirklich …? Die Schemen kamen näher. Immer deutlicher war das seltsame, klagende Geräusch zu hören – wie das Gejammer der Seelen im Fegefeuer.
Martin hastete in den Wald hinein. Schon nach wenigen Schritten hatte ihn die Finsternis eingehüllt. Zweige peitschten ihm ins Gesicht; raue Blätter und Nadeln stachen ihm in Hände und Beine. Er spürte es kaum. Immer wieder schaute er hinter sich. Aber niemand schien ihm zu folgen. Dann blieb er stehen und hielt den Atem an.
Aus der Ferne drang noch immer das leise Zischen der Flammen, doch da, wo er stand, war es vollkommen still. Auch die jammerhaften Laute waren verstummt. Und von den Schemen war nichts mehr zu sehen. Warteten sie auf der Landstraße? Unter keinen Umständen durfte Martin dorthin zurückkehren – zumindest nicht, solange es dunkel war. Am Morgen würde die Macht der höllischen Heerscharen nachlassen, doch bis dahin musste Martin ausharren. Wie sehr sehnte er sich nach dem hellen Schein der Sonne, nach dem klaren Blau des Himmels und dem Gesang der Vögel! Es war ihm, als trennten ihn davon die bodenlosen Schächte der Hölle.
Er schlich tiefer in den Wald hinein, denn er befürchtete plötzlich, von der Straße aus noch sichtbar zu sein. Erst als er weder den Schein des Feuers noch die im Mondlicht badende Landstraße mehr sehen konnte, blieb er stehen.
Die Stille traf ihn wie ein Hammerschlag.
Nichts raschelte, nichts regte sich; es war, als halte der Wald den Atem an. Martin gefiel diese Stille nicht. Er machte vorsichtig einen weiteren Schritt, um wenigstens das Geräusch seiner Sandalen auf dem Waldboden zu hören.
Da geschah es.
Plötzlich war alles Aufruhr und Geschrei. Er hob die Hände abwehrend vors Gesicht. Etwas zischte ihn an. Blätter wirbelten auf. Gekreisch. Eine Hexe! Die teuflischen Mächte! Er war in ihr Gebiet eingedrungen! Das Gekreisch erhob sich über ihn, ein Ast schlug ihm gegen die Wange. Er sank auf die Knie. »Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name …« Dann vergrub er das Gesicht in den Händen. Das Gekreisch entfernte sich; Stille floss zurück in das leere Becken der Nacht. Martin wagte es, den Kopf zu heben. Dort oben war es.
Es flog immer höher, hinauf zu den sternumkleideten Wipfeln, und war schließlich aus seinem Blickfeld entschwunden. Dem Umriss nach mochte es eine große Eule gewesen sein, die er durch sein Umhertappen aufgescheucht hatte, doch wer vermochte zu sagen, dass es nicht ein grässlicher, geflügelter Teufel gewesen war, den Martins Gebet vertrieben hatte? Aber tief in seinem Innern wusste er, dass es nur eine ganz gewöhnliche Eule gewesen war, so wie man sie manchmal im Gebälk der Klosterscheune beobachten konnte.
Читать дальше