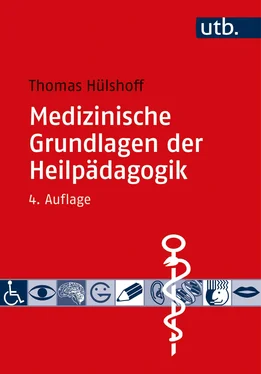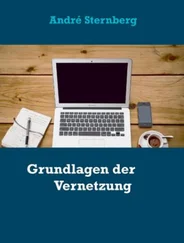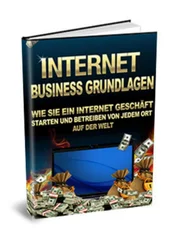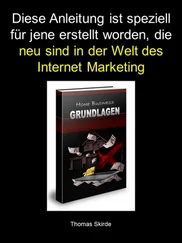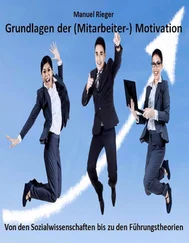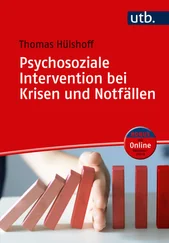1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 Wir sehen: Dass ein Kind eine Sprache erlernt, ist genetisch angelegt. Welche Sprache es erlernt, ist kulturabhängig. Wir sehen weiterhin: Die relative Unreife des menschlichen Gehirns kann durchaus als evolutionärer Fortschritt gewertet werden – ermöglicht sie dem Gehirn doch, in wichtigen Prägephasen (vielleicht sollte man besser von Entwicklungsfenstern sprechen) in der Interaktion mit der Umwelt Lernerfahrungen zu machen, die sich auch auf die neuroanatomische Feinstruktur des Gehirns auswirken. Vereinfacht kann man sagen: Die Grobverschaltung des Gehirns ist genetisch festgelegt und wird vor allem intrauterin durch chemische Substanzen getriggert. Dabei entstehen in etwa doppelt so viele Nervenzellen, als der Mensch später benötigt. Auch die Synaptogenese führt zu einem erheblichen Überschuss an Synapsen. Das macht die Verschaltungen relativ „grob“ und führt zu zahlreichen Überlappungen und Ungenauigkeiten.
Feinabstimmung
Die „Feinabstimmung“ allerdings vollzieht sich in der Interaktion der bereits gereiften neuronalen Subsysteme mit den peristatischen Informationen aus der Umwelt in prägenden Entwicklungsphasen. Dabei werden zum einen die neuronalen Module und Bahnen, die häufig gebraucht werden, gefestigt. Auch entstehen mit jedem Lernvorgang zahlreiche neue Synapsen, die durch wiederholten Gebrauch ebenfalls gefestigt werden. Andererseits gehen nicht nur etwa die Hälfte aller (überflüssigen) Synapsen, sondern auch ein Großteil nicht gebrauchter Neurone im Laufe dieses Entwicklungsprozesses zugrunde. Die Hirnreifung besteht also darin, dass genetisch angelegte neuronale Systeme verfestigt und verfeinert werden, indem überschüssige Zellen und Synapsen eliminiert und die tragfähigen, brauchbaren Strukturen erhalten und gefestigt werden. Den Abschluss dieser Entwicklung bildet die Myelinisierung, die die nun entstandenen und oft dauerhaften neuronalen Netze in ihrer Effizienz verstärkt. Erst mit diesem letzten Schritt bildet sich beispielsweise die Fähigkeit des bleibenden episodischen Gedächtnisses, das wir etwa ab dem dritten bis vierten Lebensjahr erwarten dürfen.
Entwicklungs-störungen
Dieser Prozess der kindlichen Hirnentwicklung ist durchaus störungsanfällig – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wie schon erwähnt, können genetische sowie intrauterine „Störungen“ zu einer Verletzlichkeit (Vulnerabilität) neuronaler Subsysteme führen. Aber auch physische (Infektionen, Flüssigkeitsmangel, Impfschäden) wie psychosoziale (Deprivation, Traumen, Stresssyndrome) Schädigungen vor allem im ersten Lebensjahr können sich in erheblichem Maße negativ auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns und seine Funktionen auswirken. Dies gilt nicht nur für den motorischen und sensorischen, sondern in besonderem Maße auch für den emotionalen, sprachlichen und kognitiven Bereich. In den entsprechenden Kapiteln wird hierauf detaillierter einzugehen sein. Was heißt dies nun für die Pflege und Erziehung des Kindes?
Pflege und Erziehung
Das Gehirn entwickelt sich stürmisch in der pränatalen Phase und im ersten Lebensjahr. Die Entwicklungsgeschwindigkeit verlangsamt sich zwar, doch kommt sie, was den physiologischen Prozess angeht, erst gegen Ende der Pubertät zum Stillstand. Auch danach ist das Gehirn bis an unser Lebensende plastisch. Aber die eben beschriebenen Vorgänge weisen darauf hin, dass es für zahlreiche motorische, sensorische und kognitive Fähigkeiten des Menschen sensible Phasen, Entwicklungsfenster, gibt, in denen Fähigkeiten wie das Gehen, die Sprache o. a. optimal erlernt werden. Manche dieser Fenster sind relativ breit und unspezifisch, andere sehr eng und hoch spezifisch: Den Dialekt unserer Muttersprache erlernen wir nur in den ersten Lebensjahren. Das Wissen um solche Entwicklungsfenster kann gar nicht ernst genug genommen werden und wird deswegen für jede in diesem Buch beschriebene kognitive Fähigkeit an gegebener Stelle vertiefend erläutert.
1.3Biochemische Grundlagen
Wie wir gesehen haben, können spezifische Rezeptorstellen an den Dendriten durch für sie charakteristische chemische Substanzen so verändert werden, dass Ionenkanäle geöffnet werden und somit ein bioelektrischer Reiz entsteht.
neurotrop/psychotrop
Solche chemischen Substanzen beeinflussen also die Erregung und werden als „neurotrop“ oder „psychotrop“ – auf das Nervensystem bzw. die Psyche wirkend – bezeichnet. Zu diesen Substanzen gehören zunächst die Neurotransmitter, spezifische Botenstoffe unseres Nervensystems, die wesentlich im Dienst der Erregungsübertragung stehen. Sie versorgen oft zielgerichtet ganz bestimmte Erregungsbahnen. Neurotransmitter können einfache Aminosäuren sein, wie z. B. das Glutamat. Sie können aber auch aus Nahrungsbestandteilen zu Monaminen synthetisiert werden, wie etwa das Dopamin oder Noradrenalin. Schließlich gibt es großmolekulare Peptide, die als Neurotransmitter fungieren können.
Hormone
Hormone haben einen größeren Wirkradius, da sie in der Regel über das Blutsystem viele Organe erreichen. Auch sie können gezielt das Nervensystem beeinflussen, beispielsweise die körpereigenen Endorphine, die an zentralen Stellen der Schmerzbahnen eingreifen. Auch in der Natur vorkommende pflanzliche Stoffe (bzw. Pflanzengifte) können beim Menschen psychische oder neurophysiologische Wirkungen hervorrufen: z. B. das eine Atemlähmung verursachende indianische Pfeilgift Curare, aber auch das aus der Koka-Pflanze gewonnene Kokain oder die Opiate des Schlafmohns.
Vom Menschen extrahiert, chemisch verändert oder synthetisiert können solche Stoffe als Drogen genommen werden, um eine höchstmögliche (oft gefährliche) psychische Wirkung zu entfalten. Schließlich können, völlig neu synthetisiert oder sich von pflanzlichen Wirkstoffen herleitend, psycho- oder neurotrope chemische Substanzen entwickelt werden, die als Psychopharmaka eingesetzt werden. Als Beispiel wären hier Neuroleptika, Antidepressiva und Tranquilizer zu nennen.
Wirkmechanismen
Prinzipiell sind unterschiedliche Wirkmechanismen vorstellbar, um die Wirkung von psychotropen Substanzen – seien sie Drogen oder Arzneimittel – zu erklären: So kann bereits die Produktion eines Neurotransmitters in der „Senderzelle“ blockiert oder gehemmt werden, wie dies z. B. bei manchen Antidepressiva der Fall ist. Das Medikament kann aber auch – wie im Falle des Naloxons, eines Mittels, das bei Opiatvergiftungen gegeben wird – den Rezeptor der Empfängerzelle blockieren. Somit kann der Neurotransmitter (oder das zuvor gegebene Rauschmittel) nicht mehr „andocken“. Auch der Abbau des spezifischen Neurotransmitters kann verzögert oder manipuliert werden: Er ist dann länger wirksam. Beispiele für diesen Mechanismus finden wir bei manchen Neuroleptika und Antidepressiva. Schließlich können psychotrope Substanzen massiv in den Stoffwechsel der empfangenden postsynaptischen Strukturen eingreifen, was als Beeinflussung des „second messenger systems“ (indirekte Wirkung über „zweite Boten“) bezeichnet wird.
Oft sind es strukturelle Ähnlichkeiten auf molekularer Ebene, die, beispielsweise bei Morphin und seinem Gegenspieler Naloxon, am Rezeptor wirken: An bestimmten Stellen kann sich Naloxon im Rezeptor einklinken, so dass das Morphin an dieser Stelle seine Wirkung nicht mehr entfalten kann. Eine solche Strukturähnlichkeit liegt immer dann vor, wenn Medikamente oder Suchtstoffe einen Neurotransmitter „imitieren“, am Rezeptor andocken und somit den natürlichen Botenstoff blockieren (so dass das Medikament hemmend wirkt). Bei anderen Wirkstoffen kann dieses Andocken aber auch dazu führen, dass das Medikament selbst die Neurotransmitterfunktion erfüllt und somit die Zelle erregt.
Hemmung und Erregung
Читать дальше