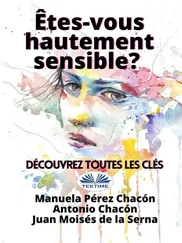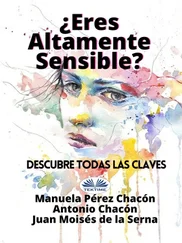1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 »Hallo, Frau Lux.«
Verwirrt schüttelten wir die Hände, und plötzlich erschauderte ich. Dafür, dass er gerade so wütend wirkte, hatte er wirklich zärtlich gesprochen. Und er fühlte sich weich und warm an. Meine Finger kribbelten komisch. Dann war der Moment vorbei, er nickte und schritt von dannen. Ich blickte zu Sascha, entschuldigte mich und eilte Doktor A nach. Mir war durch die vergangenen Minuten so vieles über ihn klar geworden und der schlimme Streit zwischen den Männern brachte mich dazu, wenigstens ein paar nette Worte zu ihm sagen zu wollen. »Augenblick bitte, Doktor Schneid?«
Sie rief nach mir. Warum?
Ich drehte mich um und sah auffordernd zu ihr herab. Was war das in ihrem Blick? Das war mir schon aufgefallen, als sie im Raum aufgetaucht war. Hatte sie Angst vor mir?
»Ja?«, sagte ich.
Sie zuckte zusammen – das war wohl etwas laut gewesen.
Verdammt, eben wusste ich doch noch, was ich sagen wollte.
Da stand sie und schwieg mich an. Was sollte das, was beabsichtigte sie damit? Erst Vater und nun strapazierte auch sie meine Nerven? Sie war wohl kaum gekommen, um mich zu trösten. Ich atmete tief ein, das schien sie noch mehr zu verunsichern.
»Frau Lux, bitte sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ihre Augenbraue zuckte. War sie jetzt beleidigt? Sie ließ den Blick über meinen Körper schweifen, also tat ich es ihr gleich. Sie trug enge Blue Jeans, die sie bis zum Knie aufgerollt hatte. Wieder blieben meine Augen an ihren strammen Schenkeln hängen. Das bemerkte sie und drehte ihre Umhängetasche vor ihren Schoß. Trotzig straffte sie die Schultern und sagte betont: »Ich wollte … Wegen gestern …«
»Was?«, fragte ich ungeduldiger, als ich es meinte.
Dann tauchte Vater in der Tür auf. Er hatte sich den ganzen Weg vom Sessel zum Türrahmen gekämpft, um nach seinem Liebling zu sehen. Dem Kind, der Tochter, die er nie hatte. Er warf mir einen wütenden Blick zu, woraufhin ich zu Frau Lux sagte: »Wenn das alles ist, gehe ich jetzt. Und Sie machen lieber Ihre Arbeit, der Verlag bezahlt Sie nicht fürs Nichtstun.«
Den letzten Satz sagte ich mit Blick auf Vater, der hinter ihr stand. Sodann drehte ich mich um und ging.
Was sollte das denn? Erst starrt er mir auf die Muschi und als Nächstes wirft er mir Faulheit vor? Ich atmete durch. Gut, das waren dann wohl genug Chancen. Ich wandte mich um und erblickte Saschas Gesicht. Seit wann stand er da?
°°°
Sascha bat mich, an seinem Bett mit meinem Notizblock Platz zu nehmen, und begann zu reden. Das Sprechen fiel ihm sichtlich schwer, doch er wurde davon nicht müde. Er schmückte nicht aus, behielt das Wasserglas in der Hand, um regelmäßig zu nippen. Ich nahm alles auf, hörte zu, erfuhr so vieles, schwieg. Und unterdrückte meine Tränen. Mein Hirn war ganz voll, ich wollte nach Hause und meine Gedanken ordnen. Wie ein großer Klumpen schwoll der Text in meinem Kopf an. Jegliche Ablenkung war schlecht. So nahm ich Saschas diesmal so viel liebevollere Verabschiedung gar nicht richtig wahr: »Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich dessen annehmen, Fräulein Lux ... Austen. Dass Sie diejenige sind, bedeutet mir viel ... Das Ergebnis wird fantastisch sein.«
»Ach, Herr Schneid, was wäre ich ohne Ihr überschwängliches Lob.« Ich lachte und gab ihm die Hand. Er hielt sie einen Moment zu lange fest, sah mir in die Augen, nickte anerkennend, dann entließ er mich.
Zum Glück war ich mit der Bahn gekommen, so hatte ich auf dem Heimweg genug Zeit und damit ausreichend Konzentrationskapazität, um alles zu verdauen. Erst als es draußen schon dunkel war, kam ich zu Hause an, und verschanzte mich sogleich hinter meinem Schreibtisch.
Ich begann zu tippen. Wie immer tauchte ich dabei ab, in die tiefen Welten meiner Vorstellungskraft. Ich ordnete das Erzählte, meine Eindrücke, zog Rückschlüsse und tippte, tippte, tippte. Mein Tee wurde ungetrunken kalt, mein Magen knurrte. Abwesend griff ich immer mal in die Tüte mit babschen Keksen. Als der Morgen graute, stand mein Gerüst für Saschas Lebensgeschichte.
Er ging einst aus einer der Vergewaltigungen seiner Mutter Regula durch russische Besatzer hervor – darum sah er so anders aus als seine Geschwister, darum nannten sie ihn Ivan, darum behandelten ihn alle lieblos. Alle bis auf Regula. Viel später ging mir auf, dass die rotblonden Locken und vermutlich auch das sanfte Wesen seiner Frau Adelheid ihn an seine Mutter erinnert hatten. Als Kind gab sich der kleine Ivan alle Mühe, möglichst deutsch zu wirken. Er bemühte sich um einen guten Satzbau, verliebte sich in die Literatur, die Märchen, hasste alles Russische. Dass Alexander ausgerechnet Russland zu seiner Wahlheimat und zum Handlungsort seiner Karriere machte, musste für Sascha ein Dolchstoß rücklings ins Herz gewesen sein.
Von Justus Schneid, dem Mann seiner Mutter, den er Vater nannte und den auch seine Geschwister zu siezen hatten, bekam er stets nur Tadel und Kälte. Erst als dieser und Regula schon tot waren, erfuhr Sascha von seiner älteren Schwester, was er lange vermutet hatte. Es erklärte, warum er so viel größer als seine Brüder war, warum sein Haar hellbraun, nicht schwarz wie das von Justus und seinen Geschwistern war, und sein Gesicht so anders aussah. Und er erinnerte sich daran, wie ihn Vater Justus kurz nach seiner Heimkehr aus dem Kriegsgefangenenlager als russischen Bastard bezeichnet hatte. Noch ganz genau wusste das Sascha, wie er von Regula gerufen wurde. Obgleich er viel zu klein gewesen sein musste, den Sinn dieser Worte zu verstehen.
Denn danach hatte seine Mutter zum ersten Mal gegen ihren Mann aufbegehrt und geschworen, sie würde ihn verlassen, nenne er das Kind noch einmal so. Natürlich war es Ende der Vierziger Jahre in Deutschland fast unmöglich für eine Frau mit drei kleinen Kindern durchzukommen.
Trotzdem hatten es viele von ihnen geschafft – schaffen müssen. Wenngleich Regula nun einen gebrochenen Gatten voller Hass zu Hause hatte, es ging ihr wohl besser als jenen Trümmerfrauen ohne Ehemann. Sie wäre dennoch bereit gewesen, das aufzugeben. Das musste Vater Justus maßgeblich beeindruckt haben. Aber erweichen konnte er sich zeitlebens nicht für das Kind.
Justus fand bald nach seiner Heimkehr Arbeit im hessischen Bad Wildungen, wohin ihn seine Familie mitsamt dem kleinen Sascha folgte. Mit den Fünfziger Jahren kam der Aufschwung nach Westdeutschland und mit ihm der Wohlstand für Familie Schneid. Alle Kinder, mittlerweile waren sie zu fünft, besuchten gute Schulen, später Universitäten. Für Sascha stand fest: Er würde Autor werden! Doch obwohl er Poesie, Lyrik und Schrift liebte – er brachte es nur zu einem kleinen Reporter für die städtische Presse. Darüber lernte er Adelheid kennen, ein kränkelndes gedichteschreibendes Mädchen – es war beiderseits Liebe auf den ersten Blick. Nach der Verlobung traf Sascha Adelheids Onkel, der gerade einen Verlag gegründet hatte. Der nahm den wissbegierigen, jungen Mann unter seine Fittiche. Wenngleich Sascha selbst nur mäßige Zeilen fabrizierte, wusste er, was große Kunst war. Sein Gespür für wahres Talent blieb in all den Jahren Erfolgsgarant für das Verlagshaus und Sprungbrett für zahlreiche Namen. Sascha war die Geheimwaffe des Unternehmens, agierte als stiller Lektor, später präsentierten sie ihm nur noch die engste Auswahl.
»Nachdem meine Frau verstorben war«, setze er an, ohne mir zu verraten, woran, »ging es mir schlecht.« Ich hatte im Laufe seines Redeflusses nur mitbekommen, dass Alexander zu diesem Zeitpunkt erst zehn Jahre alt gewesen war. Sascha hatte sich in die Arbeit gestürzt, sich mit Prosa abgelenkt. Bücher wurden seine Fluchten. »Vermutlich hätte ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen sollen«, bekannte er knapp und monoton und fuhr fort mit den großen Namen, die dank ihm prächtige Buchdeckel schmückten. So vergingen die Jahre, sein Leben. Die Mauer fiel, der Euro kam, all das spielte für Sascha in einer fernen Welt.
Читать дальше