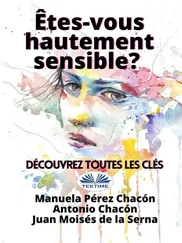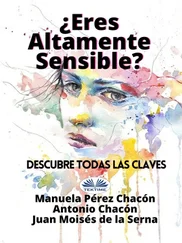Sehr befremdet sahen mich die anderen Kursteilnehmerinnen an, aber Svetlana schien über meinen Enthusiasmus froh zu sein. Nicht selten war ich Kursbeste, doch heute tat ich mich wohl besonders hervor.
Nach der Einheit hatte ich immer noch Wut und Energie übrig und traf mich am Nachmittag spontan mit Valeria zum Laufen. Natürlich hielt sie mir einen Vortrag darüber, dass mein Übertraining genau das Gegenteil von gut für meinen Körper sei. Sie merkte aber schnell, dass ich mich abreagieren musste und Gegenrede bei mir auf verbrannte Erde fiel. So tat sie geduldig mehr, als es die Aufgabe einer bloßen Laufpartnerin war, und hörte sich, während wir durch den Park walkten, wieder und wieder mein Geschimpfe an.
Der unvergleichlich schrille Klingelton von Doktor A weckte mich des nächtens aus meinem Traum. Ich hatte vergessen, das Telefon leise zu stellen, und stellte mich tot. Es bimmelte ewig. Und kaum endete es, ging es erneut los. Der Schnösel versuchte es ganze vier Mal. Ich dachte tatsächlich darüber nach ranzugehen. Dann Stille. Grinsend atmete ich aus und drehte mich um. Sofort läutete es wieder – Saschas Klingelton! So schnell, wie ich konnte, hob ich ab.
»Ja?«, stieß ich wacher hervor, als mir lieb war.
»Frau Lux …«, brummte die verhasste Stimme seines Sohnes.
»Was zum …?«
»Bevor Sie toben, es geht um meinen Vater.«
Der Tonfall von Doktor A klang ungewohnt … brüchig. Schlagartig war ich hellwach. Er brauchte nichts weiter zu sagen, nichts anzudeuten – ich verstand alles. »Ich bin unterwegs.«
Mitten in der Nacht und unter der Woche schläft manchmal sogar eine Stadt wie Berlin. Zum Glück lag heute eine Ruhe in ihrer Aura, die ausgeschaltete Ampeln, leere Zebrastreifen und nicht zuletzt freie Straßen mit sich brachten. In Rekordzeit fuhr mich mein Sportage von Pankow zur Charité, auf wackeligen Beinen rannte ich am Pförtner vorbei, den bekannten Weg durch die sterilen Gänge in Saschas Zimmer.
Da lag er, und bei ihm saß sein Sohn. Er hielt die Hand seines Vaters, kämpfte sichtlich mit den Tränen und zuckte zusammen, als ich den Raum betrat. Sofort kehrte Härte in sein Gesicht zurück, dann erhob er sich und drehte mir den Rücken zu. Ich tat ihm den Gefallen, suchte nicht nach seinem Blick, sondern trat neben ihn und schaute Sascha an.
Er war fast weg, doch er schien meine Anwesenheit zu spüren. Ein schwaches Lächeln umspielte seinen eingefallenen Mund. Noch immer hielt Doktor A seine Hand und drückte sichtlich fester zu, als ich zärtlich die Schulter seines Vaters streichelte und nach der anderen Hand fasste.
Sturzbäche aus Tränen säumten mein Gesicht, schon seit ich aus dem Auto gestiegen war. Nun entfleuchte mir ein klagendes Schluchzen. Nicht eine Sekunde dachte ich darüber nach, vor dem Stinkstiefel neben mir Haltung zu wahren.
Dann holte Sascha schwach Luft und er flüsterte etwas. Es war der Name Austen. Ich brach zusammen, vergrub meine Stirn an seinem spindeldünnen Arm. Noch einmal entrann ihm ein Wort. Alexander. Hatte der es gehört? Er stand so weit weg. Ich nahm all meine Kräfte zusammen, um deutlich zu sagen: »Wir sind hier, Sascha.«
Der lächelte und diesmal entfuhr ihm »Schön« und »Kinder«.
Ich hoffte sosehr, sein Sohn hätte wenigstens das vernommen. Es dauerte einen Moment, dann kniete Doktor A sich neben mich und sagte: »Es ist gut, Vater. Wir sind hier.«
Sascha starb mit diesem Lächeln. Die Maschine hinter ihm pfiff leise. Nun erst wurde mir gewahr, dass sich eine Schwester im Zimmer aufgehalten hatte, die nun hinausschlich, um die Ärztin zu holen. Und mir war klar, dass sie den Todeszeitpunkt verkünden sollte. Meine Tränen endeten nicht.
Neben mir kniete immer noch Doktor A und ich spürte, dass er mich ansah. Ich erwiderte seinen Blick. Seine Augen durchzogen rote Äderchen, jedoch keine Spur von Tränen.
»Frau Lux«, sagte er so leise, wie er konnte. Vermutlich konnte man mit so einer tiefen Stimme nicht flüstern. »Danke, dass Sie hier sind.«
Irrte ich mich oder wollte er mich umarmen? Alles in mir sträubte sich, ihn so zu sehen. Er trug wie immer einen tiefschwarzen Anzug, doch der war durchgeschwitzt und verknittert. Doktor A hockte mit mir auf dem polierten Boden und sah so dermaßen verlassen und hilflos aus.
Ich schüttelte das Gefühl in mir ab. Bevor ich Mitgefühl für diesen Klotz zulassen würde, fuhr ich alle Schutzschilde hoch.
Ich hatte einen so wichtigen Menschen verloren. Wollte mir sparen, mich um jemanden zu sorgen, der mir nichts bedeutete. Langsam erhob ich mich. Doktor A kniete immer noch dort und sah flehentlich zu mir auf. Das wurde mir zu viel und ich wich einen Schritt zurück. Er öffnete den Mund und sagte: »Ich möchte …«
Genau in diesem Moment kam die Ärztin herein, nickte uns zu, Doktor A verstummte augenblicklich und stand auf.
Sascha wurde für tot erklärt. Sofort weinte ich noch mehr. Die Schwester trat auf mich zu, strich mir über die Schulter. Ich sah sie an. Bedeutungsvoll öffnete sie ihre Arme ein bisschen, und ich huschte hinein. Sie wiegte mich an ihrem massigen, warmen Körper und ließ mich klagen und flennen. Die Blicke von Doktor A bohrten sich spürbar in meinen Rücken. Was hatte er denn gedacht? Dass ich mich an seiner Schulter ausweinen wollte? Im Augenwinkel sah ich ihn eilig das Zimmer verlassen.
°°°
»Willst du echt nicht, dass ich dich begleite?«, fragte Woolf.
»Nein, ich schaffe das.«
Zärtlich strich ich meine Kleider glatt. Ich hatte mich für eine langärmlige schwarze Bluse mit Nadelstreifen und einen knielangen schwarzen Bleistiftrock entschieden. Dazu klassische, sehr hohe Pumps.
»Ich möchte dir aber gerne beistehen, Jane. Ich komme mit!«, verkündete Woolf und wandte sich ab, um sich fix in seine Trauergarderobe zu werfen.
»Woolf Eugen Lux«, donnerte ich ihm daraufhin hinterher, und er sah mich erschrocken an, »du wirst mit deinem Arsch brav zu Hause bleiben. Hast du mich verstanden?«
Ich wurde ihm gegenüber so selten laut, dass er kapierte und gehorchte.
Anderthalb Wochen waren seit Saschas Tod vergangen. Inzwischen war Samstag, der Tag seiner Beerdigung. Es war warm draußen. Vom Regen am Morgen übriggebliebene Wolken bedeckten den Himmel. Mit der Tram konnte ich fast bis vor die Tore des Sophienfriedhofs fahren. Vor dem Haupteingang und der Kapelle bildete sich bereits eine Menschentraube. Ich schlich hin. Irma, die Pressesprecherin des Verlags, Joschua und Adele, zwei Talente, die Sascha entdeckt und gefördert hatte, erblickten mich und lächelten, so gut sie konnten. Ich ging zu ihnen und nahm ihre tröstende Umarmung entgegen. Wir plauderten über dies und das, versuchten zu scherzen, dass wir wohl dazu verflucht seien, uns immer nur auf Messen zu treffen. Buchmessen oder Totenmessen.
»Wir gehen hiernach zu einem Leichenschmaus. Komm doch mit, Austen. Herr Schneid hätte es so gewollt«, flüsterte Irma, während sie mir den Arm streichelte.
»Eigentlich mag ich lieber für mich sein.«
»Mensch, bist du das nicht seit zehn Tagen?«, hakte Joschua nach.
Er hatte also davon gehört, dass ich mich nach der Todesnacht Saschas zu Hause verbarrikadiert und wenig gegessen oder geschrieben hatte. Nicht mal auf Anrufe, geschweige denn auf Nachrichten aus meinen einschlägigen sozialen Netzwerken hatte ich reagiert, und war natürlich weit entfernt davon gewesen, mit Valeria zu trainieren. Doch es hatte sich gut angefühlt. Ich schlief viel, dachte nach, weinte, ließ meiner Trauer freien Lauf. Sascha hätte gewollt, dass ich meinem Herzen folge, und das wollte allein und kummervoll sein.
Im nächsten Augenblick fuhr ein nachtschwarzer Porsche Cayenne vor.
»Na, schau mal, wer da kommt ...«, zischte Adele. Offenbar konnte wirklich niemand den Sohn des Verstorbenen leiden. Doktor A stieg aus der Fahrertür, straffte, ohne irgendwelchen Blicken zu begegnen, seine breiten Schultern und lief um das Auto. Er öffnete die Beifahrertür und eine schneewittchenartige Fee entstieg. Sie trug ihr blauschwarzes glattes Haar zu einem adretten Knoten, die vollen Lippen blutrot geschminkt. Ihr schlanker Körper wurde von einem knielangen, schwarzen Kleid, Peplum Bleistiftrock, mit halblangen Ärmeln verdeckt. Dazu schimmernde High Heels. Doktor A trug wie immer einen schwarzen Anzug und ein dunkelgraues Hemd mit passender Krawatte. Seine Augenringe waren dunkler, sein Gesicht noch eingefallener und die Ader auf seiner Stirn schien schmerzhaft zu pulsieren. Er führte seine Frau an den Wartenden vorbei, ohne auch nur einmal zur Seite zu sehen. Sie hingegen nickte allen höflich und so aufmunternd wie möglich zu und nahm dann die Beileidsbekundungen der Pfarrerin entgegen. Als die beiden die Kapelle betreten hatten, setzten sich die übrigen Trauernden in Bewegung.
Читать дальше